
Von Hoyerswerda nach Hanau – rechter Terror und struktureller Rassismus waren nie Einzelfälle. Wir fühlen mit den Angehörigen und Freund*innen der Opfer von Hanau und fordern lückenlose Aufklärung! We remember and we won’t forget.
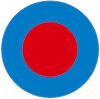
korientation ist eine (post)migrantische Selbstorganisation und ein Netzwerk für Asiatisch-Deutsche Perspektiven mit einem gesellschaftskritischen Blick auf Kultur, Medien und Politik.


Von Hoyerswerda nach Hanau – rechter Terror und struktureller Rassismus waren nie Einzelfälle. Wir fühlen mit den Angehörigen und Freund*innen der Opfer von Hanau und fordern lückenlose Aufklärung! We remember and we won’t forget.

Zwischen dem 22. und 26. August 1992 griffen bis zu Tausend Rechtsextremist*innen zunächst die Zentrale Aufnahmestelle (ZAST) für Asylsuchende an, in der sich vor allem geflüchtete Rom*nja-Familien aufhielten. Nach der Räumung der ZAST verlagerte sich das Pogrom auf ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter*innen, das am Abend des 24. August in Brand gesetzt wurde. Die etwa 115 Vietnames*innen, darunter Kleinkinder und Hochschwangere, konnten sich zusammen mit einem ZDF-Fernsehteam und dem Rostocker Ausländerbeauftragten mit knapper Not vor dem Tod durch Rauchvergiftung in ein Nachbargebäude retten. Zum Höhepunkt des Pogroms herrschte eine volksfestartige Stimmung mit rasch aufgebauten Bier- und Imbissbuden. Bis zu 3.000 Schaulustige bejubelten die rassistische Gewalt und feuerten die bundesweit angereisten Täter*innen an. Während die Angegriffenen in der Folgezeit fast alle abgeschoben wurden und die ZAST dauerhaft geschlossen blieb, verlief die politische Aufarbeitung und strafrechtliche Verfolgung sehr schleppend. Da während des Pogroms nur wenige beweissichernde Festnahmen erfolgten, wurden am Ende nur 40 Täter*innen meist zu geringen Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt. Am 6. Dezember 1992 beschloss der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU, FDP und SPD das Grundrecht auf Asyl stark einzuschränken.
Anlässlich der Jährung des rassistischen Pogroms von Rostock-Lichtenhagen veröffentlichen wir ein Interview mit unserem Mitglied Kien Nghi Ha, das Katharina Dehn von den neuen deutschen organisationen geführt hat. Siehe Originalbeitrag unter: https://neuedeutsche.org/de/artikel/rostock-lichtenhagen-war-fuer-mich-ein-erneuter-zivilisationsbruch
Ich lebte damals als junger Student der Politikwissenschaft in Berlin und mit der Zeit machte ich mir immer weniger Illusionen über die deutsche Gesellschaft. Ich wuchs eigentlich mit dem Wunsch auf, anerkannter Teil der deutschen Gesellschaft zu sein und wollte wie viele Menschen of Color einfach wie selbstverständlich dazu gehören. Ich wollte Deutschland gerne haben und hier entspannt leben.
Aber das Pogrom gegen die vietnamesische Community in Rostock-Lichtenhagen geschah ja nicht im gesellschaftlichem und politischem Vakuum. Je nationalistischer der deutsche Wiedervereinigungsprozess eskalierte und je stärker die rassistischen Exzesse in den Parlamentsdebatten und die aufhetzende Medienberichterstattung über die angebliche „Asylantenflut“ wurden, desto wachsamer und politischer wurde ich. Ich habe in dieser Zeit so viel über die Weiße deutsche Gesellschaft gelernt und hatte das Gefühl, erstmals hinter die Maske der liberal-bürgerlichen Idylle zu blicken. Was ich dann in Rostock-Lichtenhagen ungeschminkt sah, war ein rassistischer Abgrund, der blanke Horror. So viel massenhafter dumpfer Hass gepaart mit dem selbstverliebten Selbstbild als aufgeklärte Nation der Dichter, Denker und Biertrinker. Die live im Fernsehen übertragenen Bilder von dem brennenden Sonnenblumenhaus, das tagelang wie bei einer mittelalterlichen Belagerung sturmreif angegriffen wurde, waren einfach unfassbar: Es sprengte alles, was ich mir bis dahin vorstellen konnte im modernen, angeblich so zivilisierten und demokratisch-rechtsstaatlichen Deutschland. Rostock-Lichtenhagen war für mich ein erneuter Zivilisationsbruch! Meine Gefühle waren eine bizarre und widersprüchliche Mischung aus absoluten Unglauben, Entsetzen, Abscheu, Wut, Trauer, Hilfslosigkeit und Trotz. In der unmittelbaren Situation wusste ich mir nicht besser zu helfen als einen Leserbrief an die taz zu schreiben.
Was ich in diesen Jahren ebenfalls erlebte und was mich bis heute prägt, war aber auch die Erfahrung in migrantischen, antirassistischen Zirkeln von People of Color, dass selbstorganisierter Widerstand möglich ist, dass wir solidarische Strukturen aufbauen können und trotz unserer beschränkten Mittel nicht wehrlos sind.

Die Bilder des Pogroms, das Wissen, wie der Staat und seine Institutionen darauf reagierten bzw. eher nicht reagierten, haben mein Deutschlandbild grundsätzlich in Frage gestellt. Bereits zu wissen, dass Rostock-Lichtenhagen möglich war und ein neues rassistisches Pogrom jederzeit und überall in Deutschland möglich ist, veränderte die Art und Weise, wie ich mich in Deutschland bewege, fühle und lebe. Ich stellte mir Fragen und schlug mich mit Unsicherheiten und Zweifeln herum, die ich früher nicht hatte. Wo war es noch sicher, wohin konnte ich gehen und wenn ja, wann? Ich machte mir natürlich auch Sorgen um meine Familie und Freund*innen, weil es ja offensichtlich war, dass die rassistische Gewalt allgegenwärtig ist und wir jederzeit damit rechnen müssen.
Rostock-Lichtenhagen war möglich, weil die regierende politische Elite und eine Vielzahl der demokratisch gewählten Volksvertreter*innen nicht nur komplett versagten, sondern ihre diskriminierenden und unbarmherzigen Attacken gegen das Grundrecht auf Asyl einen rassistischen Flächenbrand entzündeten. Die Polizei – wie viele andere staatliche Institutionen – gaben während des Pogroms ein jämmerliches Bild ab, weil sie so offensichtlich hilflos, orientierungslos und kopflos agierte und ihre komplette Überforderung die rassistische Gewalt nicht nur zuließ, sondern auch befeuerte. Trotz wiederholter Anforderungen wurden die Einsatzkräfte vom zuständigen Innenministerium mit viel zu wenig Personal ausgestattet, und es gibt ernstzunehmende Indizien, dass chaotische Zustände durchaus ins politische Kalkül passten, um den parlamentarischen Restwiderstand gegen eine de facto Abschaffung des Asylgrundrechts in der Verfassung zu brechen.
Wir brauchen wissenschaftliche Studien über das Ausmaß von Racial Profiling nicht nur in der Polizeiarbeit, sondern in allen staatlichen Institutionen und Verwaltungen. Wie Polizist*innen treffen auch Mitarbeiter*innen in Behörden wie der Arbeitsagentur oder dem Bundesamt für Migration und Integration Entscheidungen, die das Leben von Menschen of Color und Geflüchteten massiv beeinflussen. Daher müssen wir sicherstellen oder zumindest alle erdenklichen Mittel einsetzen, um den Einfluss von rassistischen Diskriminierungen und Vorurteilen in der öffentlichen Daseinsfürsorge möglichst auszuschließen oder mindestens zu minimieren. Dass aber bereits die Zweckmäßigkeit und Legitimität solcher Studien vom Bundesinnenministerium irrationaler Weise verneint wird, beweist nur erneut, dass institutioneller Rassismus real existiert. Solche Studien wären auch sinnvoll, um bereits laufende Maßnahmen wie Antidiskriminierungstraining und Vermittlung von Diversitätskompetenz zielgerichteter und effektiver zu machen. Auch muss unverzüglich eine wirklich unabhängige wie unparteiische Instanz mit weitreichenden Befugnissen eingerichtet werden, um Beschwerden gegen Polizeiübergriffe und Racial Profiling effektiv aufzuklären und ggf. strafrechtliche Konsequenzen einzuleiten. So weiter zu machen wie bisher macht absolut keinen Sinn, da die Polizei solche Ermittlungen selbst kontrolliert. Daher müsste die Arbeit einer neu einzurichtenden Ermittlungsinstanz nach dem Beispiel des Rundfunkrats der öffentlich-rechtlichen Medien von einem Gremium kontrolliert werden, in dem zivilgesellschaftliche Akteure wie Gewerkschaften, Kirchen, Frauenverbände und natürlich auch Migrant*innenselbstorganisationen paritätisch vertreten sind.
Wie wissenschaftliche Fallstudien belegen, war die mediale Berichterstattung in den 1990er Jahren in diesem Diskursfeld nicht nur defizitär und einseitig, sondern zum Teil auch vorurteilsbelastet und diskriminierungsfördernd, so dass diese Epoche auch branchenintern nicht als Ruhmesblatt in Erinnerung geblieben ist. Verglichen mit diesem journalistischen Tiefstand sieht die mediale Berichterstattung heute zum Teil besser aus, aber um wirklich belastbare und differenzierte Aussagen zu machen, müssten wir fall- und auch immer kontextabhängig analysieren. Dass es partielle Lernprozesse in den deutschen Redaktionen gegeben hat, liegt auch an der Kritik von postmigrantischen Initiativen wie den „Neuen Deutschen Medienmacher*innen“. Auch die vielfältigen Gegennarrationen etwa von People of Color-Initiativen und antirassistischen Organisationen, aber auch von Einzelpersonen in den unterschiedlichsten Formaten im Internet spielen eine Rolle, da sie das Informationsmonopol der etablierten Medienhäuser aufbrechen. Im Asiatisch[1]-diasporischen Kontext in Deutschland sind mit Organisationen wie „korientation – Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven“ auch neue Strukturen entstanden, die eine Plattform für kultur- und medienkritische Arbeit etwa zum aktuell virulenten Corona-Rassismus gegen Asiatisch markierte Menschen bildet.
In Zeiten, wo kulturelle Dekolonialisierung und die breitere Auseinandersetzung mit institutionellem Rassismus auf der Tagesagenda steht, wäre es für alle an der Zeit zur Kenntnis zu nehmen, wie unverantwortlich und sträflich vernachlässigend die offizielle Erinnerungskultur mit dem Gedenken an Rostock-Lichtenhagen immer noch umgeht. Es ist ein böser Witz, wenn Medien und staatliche Repräsentant*innen 2012 zum 20. Jahrestag erstmalig ein wahrnehmbares offizielles Gedenken inszenieren, wo Vertreter*innen der lokalen vietnamesischen Community erst im letzten Moment herbei gekarrt werden, um dann gänzlich stumm als schmückendes Beiwerk zu fungieren. So verkommt das leere und diskriminatorische Gedenken, wo die Betroffenen nicht mal in der Vorbereitungsarbeit einbezogen werden, zu einem bloß symbolischen Ritual der politischen Entlastung. Damit wird politische Verantwortung nicht übernommen, sondern abgeführt mit dem Verweis „Wir haben was gemacht“. Statt auf den 30. Jahrestag zu warten, müsste das Gedenken in Form einer kontinuierlichen Bildungs- und Erinnerungsarbeit erfolgen, die über die historisch-kulturellen Voraussetzungen, den konkreten Tatablauf sowie die politischen und gesellschaftlichen Kurz- und Langzeitfolgen des größten Pogroms seit 1945 in Deutschland aufklärt. Das kann nur eine museale Institution mit Dauerausstellung, begleitenden Seminaren und Diskussionen zu verwandten Themen wie etwa struktureller Rassismus in der offiziellen Erinnerungskultur: Warum gibt es auch nach 40 Jahren immer noch keinen einzigen offiziellen Gedenkort oder Straßennamen für Đỗ Anh Lân und Nguyễn Ngọc Châu, die am 22. August 1980 in Hamburg von organisierten Rechtsextremist*innen ermordet wurden? Sie gelten als die ersten gerichtlich dokumentierten rassistischen Mordopfer in der BRD seit 1945. Aber um mit einer positiven Nachricht zu schließen: Erstmalig wird Ende August 2020 die aus Privatpersonen bestehende „Initiative für ein Gedenken an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân“ auf dem Hamburger Friedhof Öjendorf einen Gedenkstein einweihen, da ihre Gräber dort bereits aufgelöst wurden.
Kien Nghi Ha, promovierter Kultur- und Politikwissenschaftler, arbeitet als Publizist und Dozent in Berlin. Seine Monografie Unrein und vermischt. Postkoloniale Grenzgänge durch die Kulturgeschichte der Hybridität und der kolonialen „Rassenbastarde“ (transcript 2010) wurde mit dem Augsburger Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien 2011 ausgezeichnet. Im Herbst 2020 gibt er die erweiterte Neuauflage von Asiatische Deutsche. Vietnamesische Diaspora and Beyond (Assoziation A) heraus. Er ist auch Mitherausgeber von re/visionen. Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland (Unrast 2007).
[1] Wie bei Schwarz deutet die Großschreibung von Asiatisch an, dass es in diesem Fall nicht als Adjektiv zur regionalen Herkunftsbezeichnung benutzt wird, sondern kulturelle Identitätskonstruktionen bezeichnet. Diese sind wie alle Identitäten umkämpft und widersprüchlich, da sowohl Praktiken der Selbstbezeichnung als auch Prozesse des Fremdwahrnehmung und des Otherings einfließen.

Sehr geehrte Damen und Herren, hallo liebe Freund*innen und Mitstreiter*innen,
Kính thưa các Quý ông và Quý bà, xin chào những người bạn và đồng nghiệp thân mến,
ich bin heute hierher gekommen, um Đỗ Anh Lân und Nguyễn Ngọc Châu zu gedenken. Sie wurden an diesem Ort vor 40 Jahren durch organisierte deutsche Rechtsextremist*innen ermordet. Es ist mir ein wichtiges persönliches wie politisches Anliegen, meinen Respekt wie meine Trauer nicht zuletzt gegenüber den überlebenden Angehörigen der Getöteten auszudrücken. Obwohl der Anlass bedrückend ist, ermutigt es mich sehr, dass die Mutter von Đỗ Anh Lân die 2014 ins Leben gerufene Gedenkinitiative* ausdrücklich unterstützt. Ich möchte ihr sagen: Bà ơi, bà không chiến đấu một mình đâu. Oma, ihr steht mit Eurem Kampf nicht alleine da. Genauso wie sie wollen auch viele andere Menschen aus der vietnamesisch-deutschen Community in und außerhalb Hamburgs einen würdigen öffentlichen Gedenkort für die hier Ermordeten schaffen.
Aber weder das Gedenken noch der Kampf für die Errichtung eines antirassistischen Lern- und Erinnerungsortes ist ausschließlich Sache der betroffenen Familie oder der sogenannten ethnischen Gemeinschaft, sondern eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Außerdem haben viele von uns am eigenen Leib erfahren, dass die rassistische Gewalt nicht wahllos, sondern zielgerichtet und community-übergreifend muslimisch, Schwarz, jüdisch, Rom*nja und Sinte*zza, Latinx oder Asiatisch[1] markierte Menschen trifft. Daher ist es nicht nur wünschenswert, sondern absolut notwendig, unsere uns eigene menschliche, emotional-kulturelle Solidarität großzügig zu leben und politischen Widerstand grenzüberschreitend zu organisieren.



Ich kannte Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân nicht persönlich, aber ihre Geschichte ist mir nicht fremd. Wären wir uns begegnet, hätte ich sie mit Chu Châu und Anh Lân, also Onkel Châu und Bruder Lân angesprochen, denn ich war damals erst acht Jahre alt. Onkel Châu war Lehrer in Vietnam und wurde 1958 in Saigon geboren. Bruder Lân kam 1962 ebenfalls in Saigon zur Welt und war zum Zeitpunkt seiner Flucht noch Schüler. Obwohl sie aus Südvietnam stammten und ich zufällig in der nordvietnamesischen Stadt Hanoi geboren wurde, kann ich mich mit ihnen identifizieren, da uns auf unterschiedlichen Ebenen eine persönliche Geschichte verbindet. Wir überlebten zufällig den Geschwisterkrieg, der im Kern ein imperialistischer US-Krieg in Vietnam war, und kamen 1979 bzw. 1980 als erste sogenannte Boat People in West-Deutschland an. Es war ebenso reiner Zufall, dass sie in Hamburg und ich mit meiner Familie in West-Berlin untergebracht wurden.
Der heimtückische Brandanschlag, der genau an diesem Ort in der Nacht zum 22. August 1980 stattfand, war dagegen sehr zielgerichtet und nicht zufällig, als er die beiden im Schlaf überraschte. Dieses Ereignis hatte zuallererst für die Betroffenen die brutalst mögliche Folge; es vernichtete das Leben von zwei jungen Männern: Bruder Lân starb bereits mit 18 Jahren und Onkel Châu wurde auch nur 22 Jahre alt. Leider ist in der Öffentlichkeit kaum mehr als das eben Gesagte über sie bekannt. Wir wissen nicht, welche Wünsche und Träume sie für sich hatten oder wie sie sich selbst und ihre Familien wahrnahmen. Wir wissen aber, dass ihre Ermordung nicht zu begreifen ist, wenn wir sie nur als tragische individuelle Schicksalsschläge deuten. Vergessen wir nicht, dass seit dem Ende der 1960er Jahre mit dem Attentat auf Rudi Dutschke eine ansteigende rechtsextreme Gewaltwelle durch die BRD rollte. Dabei kamen nicht nur nackte körperliche Gewalt und einfache Waffen zum Einsatz. Vielmehr verübten organisierte Neonazis in diversen sogenannten Werwolf‑, Kampf- und Wehrsportgruppen zunehmend Brand- und Sprengstoffanschläge. Die Tötung von Đỗ Anh Lân und Nguyễn Ngọc Châu durch die Deutschen Aktionsgruppen leitete 1980 eine dichte Serie rechtsextremer und rassistischer Terrortaten ein. So verübten Mitglieder der Wehrsportgruppe Hoffmann noch im selben Jahr den Bombenanschlag auf das Münchener Oktoberfest, der 13 Menschenleben kostete, und erschossen den jüdischen Verleger Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke in Erlangen. Wie etwa in Mölln, Solingen und Lübeck in den 1990ern Jahren, wie die unzähligen NSU-Morde eine Dekade später, aber auch der diesjährige Massenmord in Hanau wiederkehrend bestätigen, gehört der rechtsextremistische Terror gegen People of Color und Migrierte seit vielen Jahrzehnten zum rassistischen Normalzustand der deutschen Gesellschaft. Und heute vor genau 28 Jahren begann auch das größte rassistische Pogrom seit 1945 in Rostock-Lichtenhagen, das vier Tage andauerte und stundenlang live im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm übertragen wurde.
In diesem historischen Zusammenhang nimmt die Ermordung von Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân einen besonderen Platz ein: Sie sind in West-Deutschland die ersten polizeilich dokumentierten und gerichtlich nachgewiesenen rassistischen Mordopfer seit 1945. Realistischerweise ist leider davon auszugehen, dass vorangegangene rassistische Morde und Gewalttaten aufgrund der Weißen Ignoranz und der rassistischen Struktur der mehrheitsdeutschen Institutionen nicht aufgedeckt und entsprechende Verdachtsmomente nicht erkannt oder nachgegangen wurden. So sind erst in den letzten Jahren Hinweise aufgetaucht, dass die kubanischen Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Raúl Andrés Paret am 12. August 1979 von einem rassistischen Mob durch das sächsisch-anhaltinische Merseburg getrieben wurden und bei ihrem Fluchtversuch in der Saale ertranken.
Die Morde in der Halskestrasse stellen aber auch eine politische Zäsur für die vietnamesische Diaspora in Deutschland dar. Wer bis dahin glaubte, von der Weißen Mehrheitsgesellschaft als hart arbeitende Asiat*innen mit vermeintlich preußischen Tugenden anerkannt zu sein oder im Kalten Krieg dachte, als sympathische Opfer des Kommunismus respektiert zu werden, wurde in seiner trügerischen Komfortzone mit einer anderen Realität konfrontiert. So werden Nguyễn Văn Tú 1992 in Berlin-Marzahn, Phan Văn Toàn 1997 im brandenburgischen Fredersdorf, Nguyễn Tấn Dũng 2008 in Berlin-Marzhan und Duy Doan Pham 2011 im niederrheinischen Neuss von Rechtsextremisten erstochen oder grausam erschlagen. Diese Tötungen stellen Stationen in der langen Reihe rassistisch motivierter Morde in Deutschland dar. Für den Zeitraum von 1990 bis 2020 hat die Amadeu Antonio Stiftung 208 Todesopfer rechtsextremer Gewalt aufgelistet und zählt mindestens zwölf weitere Verdachtsfälle. Die Zeit und andere Medien haben über weitere 51 Verdachtsfälle berichtet. Nach meiner Zählung wurden seit 1979 in Ost- und Westdeutschland mindestens 134 People of Color und osteuropäische Migrant*innen aufgrund nachgewiesener oder vermutlicher rassistischer Mordmotive getötet.
Wie vielen von uns fällt es mir auch nicht leicht, hier zu sein, um an die Terrorgeschichte dieses rassistischen Brandanschlags zu erinnern. Das hängt nicht zuletzt mit der Tatsache zusammen, dass die Geschichte von Đỗ Anh Lân und Nguyễn Ngọc Châu nach wie vor kaum bekannt ist. Zwar wurde der Brandanschlag in den damaligen Medien kurzzeitig wahrgenommen. Aber bereits bei der Beerdigung, bei der der damalige Erste Bürgermeister Hamburgs Hans-Ulrich Klose eine Trauerrede hielt, wurden nicht nur die Opfer begraben, sondern auch das öffentliche Gedenken an diese Tat. Die städtischen Honoratior*innen und die Medien, aber auch die hiesige Zivilgesellschaft gingen danach schnell zur mehrheitsdeutschen Schein-Normalität über. Sie taten so, als ob diese Tat nichts weiter als ein peinlicher Fauxpas, ein allzu bedauerlicher Betriebsunfall war, der keinesfalls als dauerhafter Schandfleck auf der weißen Weste in Erinnerung bleiben sollte. Unausgesprochen und vielleicht auch unbewusst wurde damit ein dominanzdeutscher Konsens hergestellt, in der die unleugbare Existenz eines tödlichen Rassismus weder langfristige noch tiefgreifende Auswirkungen auf das eigene Weiße Selbstverständnis oder auf gesellschaftliche Strukturen haben sollte. Entsprechend sollte das Gedenken an diesen rassistischen Doppelmord keinen Platz in der offiziellen Stadtgeschichte, im Stadtraum und der öffentlichen Erinnerungskultur beanspruchen dürfen.
Wie gründlich diese Amnesie und wie radikal die Realitätsverdrängung des institutionellen Rassismus ist, lässt sich auch noch heutzutage erahnen: So berichtete die in Hamburg sitzende Wochenzeitung „Die Zeit“ erst im Zusammenhang mit der skandalumwitterten Aufdeckung des NSU-Terrors 2012 erstmalig seit 1980 wieder über diesen Brandanschlag. Das Medienhaus, das sich selbst als systemrelevanten Watchdog sieht, hat sich in diesem Fall merkwürdig unzufällig als Totalausfall erwiesen. Auch hat „Die Zeit“ ihre offensichtlich besondere Verantwortung für Đỗ Anh Lân gänzlich vergessen, der im August 1979 in einer von Wochenzeitung und dem Hamburger Senat initiierten Hilfs- und social Sponsoring-Aktion mit 250 anderen vietnamesischen Boat People von der malaiischen Insel Pulau Bidong in die Hansestadt transportiert wurde.
Daher ist es für uns umso wichtiger, wenigstens die Erinnerung lebendig zu halten und diese Geschichte und alle anderen Geschichten nicht zu vergessen ist, wo Menschen Leidtragende von Rassismus, Sexismus, kapitalistischen Neo-Kolonialismus und anderen menschenverachtenden Machtverhältnissen wurden und immer noch werden. Es ist wichtig, dass wir uns heute hier und anderswo versammeln, um durch unsere körperliche Präsenz und durch unser gemeinsames Gedenken zumindest ein temporäres, aber dafür lebendiges Denkmal zu improvisieren und durch unsere Stimmen einen wahrnehmbaren Gedenkraum für alle Opfer rassistischer Gewalt zu inszenieren.
Das offizielle Nicht-Erinnern ist jedoch kein Zufall, sondern die logische Konsequenz der hegemonialen Entinnerung. Damit bezeichne ich institutionelle Strukturen und politisch-kulturelle Praktiken des Vergessenmachens, der Nicht-Würdigung und Aberkennung. Dass heute kein Mahnmal, keine dauerhafte Gedenktafel, keine Straße, kein Park, keine Schule, keine Halle, kein Sportplatz, kein Bahnhof, kein Haus, kein Zug, kein Schiff, kein Stolperstein, nicht mal ihre inzwischen aufgelösten Gräber an ihre Existenz und an das rassistische Verbrechen ihrer Auslöschung erinnert, sagt extrem viel über deutsche Gründlichkeit, rassistischen Sauberkeitswahn und Weiße Stadtplanung aus. An dieser Stelle sei kurz daran erinnert, dass ihre unaussprechlichen vietnamesischen Namen dem zuständigen Bezirksamt bei der Prüfung des StraßenumbenennungsBegehrens als unpassende Fremd- und unzumutbare Klangkörper erschienen. Mir scheint dagegen, dass in der angeblich so weltoffenen Hansestadt für die Opfer des Rassismus enge bürokratische Toleranzgrenzen und sprachliche Reinheitsgebote des Eurozentrismus gelten. Umso mehr, wenn es darum geht, ihnen einen offiziellen Erinnerungsort in der heutigen Stadtlandschaft einzuräumen.
Um fair zu sein, wir kennen auch aus anderen Städten viele gleichgelagerte Beispiele, so dass die eurozentristische Aufladung bei der Benennungspolitik öffentlicher Orte kein spezifisches Problem Hamburgs ist. In der gesamtdeutschen Normalitätsvorstellung herrscht anscheinend immer noch eine urdeutsche Norm ohne Migrationserfahrungen und gegenkultureller Globalisierung. In dieser Konstruktion der deutschen Normalität erscheint es immer noch rationaler und politisch korrekter, Akteure und Orte mit kolonial-rassistischen Bezügen zu ehren als Menschen, die sich dagegen gewandt und/oder darunter gelitten haben. Umso scheinheiliger, hohler und absurder ist dieses Polit-Theater im 21. Jahrhundert, wenn im gleichen Atemzug auch noch der Anspruch auf weltpolitische und moralische Überlegenheit damit verbunden wird. In den ach so aufgeklärten, offenen und interkulturellen Demokratien des Westens ist weder die europäische Geschichte des Kolonialrassismus aufgearbeitet noch seine Gegenwart tatsächlich überwunden.
Die Umbenennung der Halskestrasse in Châu-und-Lân-Strasse, vielleicht auch Đỗ-Nguyễn-Strasse oder eine andere Namensvariation wäre aus meiner Sicht ein sinnstiftender Beitrag zur antirassistischen Umgestaltung und Dekolonialisierung deutscher Stadt- und Alltagskultur. Auf jeden Fall sollte der Senat in die Pflicht genommen werden um eventuell überlebende Familienangehörige von Nguyễn Ngọc Châu ausfindig zu machen und zu kontaktieren, um ihre Einbeziehung in den Umbenennungsprozess auf gleicher Augenhöhe sicherzustellen. Eine Umbenennung würde darüber hinaus auch dazu beitragen, unsere Ausgrenzungsmöglichkeiten zu reduzieren und unsere Vorstellungskraft davon zu verändern, wer dazu und was alles hierher gehört. Sie wäre ein kultureller und bildungspolitischer Mehrwert, den wir in Zeiten des strukturellen Racial Profiling, des unheimlichen Phänomens NSU 2.0 in der deutschen Polizei und des assimilatorischen Integrationsparadigmas unbedingt brauchen.
Was die staatlichen Sicherheitsorgane angeht, so zeigen nicht nur die jüngsten Ereignisse, dass rechtsextreme und rassistische Polizeigewalt ein massives systemisches Problem darstellen. Der Grad der Unterscheidbarkeit zwischen staatlichen Sicherheits- und Terrortruppen ist in Deutschland zuweilen erschreckend klein. Nicht nur die Polizei in unterschiedlichen Bundesländern, auch diverse Verfassungsschutzämter und Bundeswehreinheiten sind in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder durch haarsträubende Verwicklungen zu rechtsextremen Organisationen aufgefallen. Dokumentiert sind allerdings nur die aufgedeckten Fälle, aber es ist davon auszugehen, dass es in diesem Bereich eine hohe Dunkelquote an geheim operierenden Netzwerken und Tarnorganisationen gibt. Diese Verbindungen wurden vor allem durch antifaschistische Aktivist*innen und investigative Journalist*innen entdeckt, während staatliche Stellen bislang eher durch Beschwichtigungen und Dementis auffielen. Der Stellenwert rassistischer Gewalt in den Staatsorganen muss in Relation zur gesamtgesellschaftlichen Verfasstheit gesehen werden, die in ihrem Kern strukturell, administrativ-institutionell und zweifellos auch kulturell rassistische Muster aufweist. Diese Konfiguration bringt im Alltag existenzielle Probleme hervor, da nicht selten Weiße Entscheider*innen mit diskriminatorischen Vorurteilen oder Motivationen im staatlichen Auftrag handeln: Ob jemand sicher in Deutschland leben darf und kann, hängt viel zu oft von der Perspektive und der staatlich anvertrauten Entscheidungsmacht rassistischer Subjekte ab.
Wer sich die Geschichte des Rechtsextremismus in Deutschland seit dem Deutschen Kolonialkaiserreich anschaut, kann sich kaum des Eindrucks erwehren, dass sich gerade in den sogenannten Sicherheitsorganen starke rechtsextreme Tendenzen konzentrieren. Das galt nicht nur in der Weimarer Republik, sondern beispielsweise auch in den 1980er Jahren, als auffällig viele Polizist*innen sich als Mitglieder und Sympathisant*innen der völkisch-nationalistischen „Republikaner“ von Franz Schönhuber zu erkennen gaben, der früher SS-Unterscharführer war, damals als stellvertretender Chefredakteur des regionalen Fernsehprogramms des Bayerischen Rundfunks fungierte und später zur NPD abwanderte. Und es gilt auch heute: Wer jetzt durch die Mitgliedslisten der AFD geht, wird wiederkehrend auf deutsch klingende Namen mit ehrenwerten bürgerlichen Berufen stoßen. Darunter sind viele Richter*innen, Staats- und Rechtsanwälte, Staatsbeamte und andere Verwaltungsangestellte, Professor*innen, Lehrer*innen, Journalist*innen, aber natürlich auch Berufe von Architekt*innen bis Unternehmer*innen und nicht zuletzt immer wieder Polizist*innen. Wie uns leider die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mehr als einmal gelehrt hat, werden rechtsextreme Bewegungen viel zu häufig von einem strukturkonservativen Rechtssystem entschuldigt und von der Mehrheit der Weißen Volksvertreter*innen verharmlost, sehr oft mit dem Standardsatz: „Wie müssen die Sorgen und Ängste der deutschen Bevölkerung ernst nehmen.“ Befremdlich ist mir an solchen Sätzen die Selbstverständlichkeit, mit der Bürger*innen of Color, migrantische und postmigrantische Communities aus der deutschen Gesellschaft und Wähler*innenschaft ausgeschlossen werden. Menschen wie wir werden so in Gedanken quasi entbürgert, d.h. entrechtet und unsichtbar gemacht. Aber sie irren sich: Unsere Stimmen zählen und das mindestens sogar im doppelten Sinne.
Wie die Gedenk- und Erinnerungskultur zugunsten der Opfer rechtsextremer Gewalt im besten Falle aussehen kann, wenn der politische Willen vorhanden ist und eine genuine identitätspolitische Betroffenheit vorliegt, zeigt die Geschichte von Walter Lübcke. Wie wahrscheinlich alle hier wissen, war Walter Lübcke zunächst Hessischer Landtagsabgeordneter der CDU und zuletzt als Regierungspräsident in Kassel tätig bevor er im Juni 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet wurde. Sein Mord löste eine überwältigende Medienresonanz und eine sehr große Betroffenheit in der Bevölkerung aus: Es fanden mehrere Trauergottesdienste und zahlreiche Gedenkveranstaltungen in mehreren Landtagen sowie im Bundesrat statt. Ihm wurde posthum neben der Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung des Landes Hessen, auch der nordhessische Herkules-Ehrenpreis verliehen. Hessen hat zudem den neuen Walter-Lübcke-Demokratie-Preis ausgelobt; eine Schule in Wolfhagen, wo er wohnte, wird nach Walter Lübcke umbenannt und in Fulda wird es bald eine Dr.-Walter-Lübcke-Straße geben. Diese Aufzählung ist nicht endgültig, da in Zukunft sicherlich mit weiteren Ehrungen zu rechnen ist. Mir steht es fern, an dieser Stelle das politische Wirken von Walter Lübcke oder die ihm zugedachten Ehrungen in Zweifel zu ziehen. Vielmehr finde ich es sehr beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit und Dichte hier Denkmäler und öffentliche Erinnerungsorte geschaffen werden und bürokratische Anforderungen scheinbar mühelos erfüllt werden können. Das ist umso erstaunlicher, da in anderen Fällen diese von städtischen Verwaltungen als schier unüberwindbare formale Hindernisse dargestellt werden. Trotz langjähriger Bemühungen verlaufen viele Initiativen daher im Sande, während Ämter und zuständige politische Gremien mit Unschuldsmiene auf felsenfeste Vorschriften und gesetzliche Vorgaben verweisen.
Der Präzedenzfall Walter Lübcke setzt m.E. nach neue Standards im kultur- und erinnerungspolitischen Umgang mit den Opfern rechtsextremer Gewalt. Weder sachlich noch politisch oder moralisch ist es begründbar und zu rechtfertigen, dass sich eine Zweiklassengesellschaft in der öffentlichen Gedenkkultur etabliert. Da wir alle über unsere Steuern diese Gedenkkultur mitfinanzieren, verlangt nicht nur die Betroffenheit von Rassismus, sondern auch die demokratische Repräsentation eine nicht-diskriminatorische Erinnerungspolitik. Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang nicht verkehrt, die politische Elite an ihrem eigenen neoliberalen Grundsatz zu erinnern: no taxation without representation. Bisher hat der institutionelle Rassismus in den gesellschaftlichen Strukturen eine Entsprechung in der selektiven Erinnerungspolitik und öffentlichen Gedenkkultur, die systematisch Menschen of Color marginalisieren und ausschließen.
Es gibt also einen Rassismus zweiter Ordnung, etwa in Form der kulturpolitischen Institutionalisierung von Diskriminierung und Benachteiligung, die auf dem initialen körperlichen Angriff oder dem ursprünglichen strukturellen Rassismus in der Schule oder auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt folgt und ihr als sich selbst verstärkender Kreislauf gleichzeitig vorausgeht. Solange wir diese kulturelle Dimension nicht erkennen, also die zweite und weitere Ebenen des Rassismus wahrnehmen, stoßen wir an Grenzen, die die Unmöglichkeit der Erinnerbarkeit und des Erkennens von Rassismus betreffen. Diese miteinander verschränkte Komplexität zu erkennen und ihre verkrusteten Dominanzstrukturen aufzubrechen, ist eine dringend zu lösende Aufgabe in der Gegenwart. Ich denke, dass die transkontinentale Solidarität mit der US-Amerikanischen Black Lives Matter-Bewegung und ihre hiesigen Rückkoppelungen etwa in Form des erstmaligen Interesses für die Dekolonialisierung eurozentristischer Kulturstandards oder die Auseinandersetzung mit institutionellem Rassismus in breiteren Bevölkerungskreisen ein wichtiges politisches Momentum für antirassistische Initiativen bereitstellt. Jetzt geht es darum, den Mut und die organisatorische Schlagkraft aufzubringen, um in lokalen Gruppen, bundesweiten Netzwerken und globalen Bewegungen die Verhältnisse vor Ort wie in den systemrelevanten Strukturen weltweit in Frage zu stellen und lebenswerte Alternativen zu entwickeln.
Meine Rede möchte ich hier mit einer Erkenntnis der Schwarzen amerikanischen Psychologin Beverly Daniel Tatum schließen. Die von ihr beschriebene schleichende Vergiftung macht uns dauerhaft krank und führt uns als Individuen wie als Gesellschaft alternativlos zum Tode.
Sie schreibt: „Cultural racism … is like smog in the air. Some days it is so thick it is visible, other times it is less apparent, but always, day in and day out, we are breathing it in.“
Meine Übersetzung: Kultureller Rassismus … ist wie Smog in der Luft. An manchen Tagen ist er so dick, dass er sichtbar ist, an anderen ist er weniger offensichtlich, aber immer, Tag für Tag, atmen wir ihn ein.
Kien Nghi Ha, promovierter Kultur- und Politikwissenschaftler, arbeitet als Publizist und Dozent in Berlin. Seine Monografie Unrein und vermischt. Postkoloniale Grenzgänge durch die Kulturgeschichte der Hybridität und der kolonialen „Rassenbastarde“ (transcript 2010) wurde mit dem Augsburger Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien 2011 ausgezeichnet. Im Herbst 2020 gibt er die erweiterte Neuauflage von Asiatische Deutsche. Vietnamesische Diaspora and Beyond (Assoziation A) heraus. Er ist auch Mitherausgeber von re/visionen. Postkoloniale Perspektiven von People of Color auf Rassismus, Kulturpolitik und Widerstand in Deutschland (Unrast 2007).
*Initiative für ein Gedenken an Nguyễn Ngọc Châu und Đỗ Anh Lân, https://inihalskestrasse.blackblogs.org
[1] Wie bei Schwarz deutet die Großschreibung von Asiatisch an, dass es in diesem Fall nicht als Adjektiv zur regionalen Herkunftsbezeichnung benutzt wird, sondern kulturelle Identitätskonstruktionen bezeichnet. Diese sind wie alle Identitäten umkämpft und widersprüchlich, da sowohl Praktiken der Selbstbezeichnung als auch Prozesse des Fremdwahrnehmung und des Otherings einfließen.