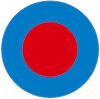Text und Recherchen: Anujah Fernando, Linh Müller
Dieser Artikel ist Teil des Projektes „Asiatische Präsenzen in Berlin“. Im Rahmen dieses Projektes wurde der vorliegende Artikel sowie zwei Wissensmodule in Form von thematisch fokussierten Materialsammlungen erstellt: Antikoloniale Vernetzung von Inder:innen im Berlin der Zwischenkriegszeit sowie Koreaner:innen im Berlin der Zwischenkriegszeit. Diese können als Ausgangspunkte für weiterführende Recherchen und inhaltliche Vertiefungen genutzt werden.
Zitiervorschlag Artikel: Anujah Fernando und Linh Müller (2022): Asiatische Präsenzen im Berlin der Zwischenkriegszeit: Inder:innen, Koreaner:innen und Community übergreifende Begegnungen, korientation, https://www.korientation.de/asiatische-prasenzen-berlin-zwischenkriegszeit-inderinnen-koreanerinnen-begegnungen, abgerufen am [DATUM].
Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Anwesenheit von Menschen aus dem asiatischen Raum im Berlin der Zwischenkriegszeit, im Speziellen mit Menschen aus dem koreanischen und indischen Kontext. Indem wir den Blick auf die Präsenzen von Menschen aus dem asiatischen Raum in Berlin richten, möchten wir zum Einen historisches Wissen vermitteln und Lücken und Leerstellen in dominanter Geschichtserzählung schließen. Zum Anderen erhoffen wir uns, in der Vermittlung dieser Fallbeispiele auch mit vereinfachenden Narrativen von Asien zu brechen, indem wir die komplexen Verflechtungen kolonialer Geschichte anhand konkreter Lebenswege in Berlin skizzieren. Zuletzt möchten wir außerdem mit einem besonderen Fokus auf die politische Selbstorganisierung von Koreaner:innen und Inder:innen[1] im Berlin der 1920er die Perspektive der Community-übergreifenden Begegnung und Solidarisierung einfangen und sichtbar machen.
Auf Grundlage des aktuellen deutsch- und englischsprachigen Forschungsstands versuchen wir, die Anwesenheit koreanischer und indischer Kolonialmigrant:innen in Berlin zu rekonstruieren, historisch zu kontextualisieren, wenn möglich räumlich zu verorten, und somit jene ansonsten disparat beforschten Communities hier in Verbindung zu bringen. Durch ein sensibles Gegenlesen der aktuellen Forschung und diverser Primärquellen identifizieren wir Momente der Eigensinnigkeit und Widerständigkeit sowie der Verbindung und der lokalen Kooperation zwischen Koreaner:innen und Inder:innen in Berlin. Da die ausgewählten Fallbeispiele im Berlin der Weimarer Zeit sich auch unter dem Vorzeichen des antikolonialen Befreiungskampfs begegneten, der sich auch über Berlins Grenzen hinweg fortsetzte, gehen wir auf zentrale transnationale Begegnungen ein, wie beispielsweise den Brüsseler Kongress. Die Methode des Gegenlesens aus dem Jetzt birgt dabei stets die Gefahr der nachträglichen Romantisierung historischer Ereignisse und Personen. Dem begegnen wir, indem wir den Fokus auf konkrete historische Akteur:innen und ihr jeweiliges politisches Handeln legen – und, wo möglich, auf die ambivalenten und stellenweise strategischen Positionierungen der Akteur:innen hinweisen, ob in Organisationsgründungen, politischen Aktionen oder Kollaborationsbemühungen.
In der Annäherung aus der Gegenwart an indische und koreanische Kolonialgeschichte in Berlin braucht es auch einen wachen Umgang mit nationalistisch geprägten Begriffen wie Indien, aber auch mit Umbrella Terms wie Asien. All diesen Konzepten ist gemeinsam, dass sie je nach historischem und politischem Kontext unterschiedlich genutzt wurden und zum Teil divergente Zielsetzungen damit verbunden sind.[2] Auch begegnen wir den historischen Akteur:innen aus dem Jetzt mit der Zuschreibung von aus der Gegenwart geprägten Konzepten, wie etwa dem Community-Begriff. Wir haben uns dazu entschieden, das Konzept nutzbar zu machen, weil es uns die jeweilige soziale Verräumlichung der in Berlin anwesenden koreanischen und indischen Menschen ermöglicht. Für diesen Artikel verfolgen wir indes die Strategie, auf den Konstruktionscharakter dieser Begriffe und Konzepte zu verweisen, indem wir gewisse Begriffe kursiv setzen. Eine ähnliche Herausforderung stellt sich bei der Zuschreibung von Geschlecht. Die historische Quellenlage, meist aus eurozentrischer Perspektive geschrieben, verweist dabei auf Männer. Somit haben wir weniger das Handeln von Frauen, gar nicht von Non-Binären oder Trans*Menschen in unseren Fallbeispielen einbeziehen können. Für den Artikel haben wir uns dazu entschlossen, an jenen Stellen, wo die geschlechtliche Selbstpositionierung unklar ist bzw. aus den Quellen nicht explizit hervorgeht, wie sich die Bezeichneten selbst beschreiben, möglichst gender-inklusiv zu formulieren und so Ausschließungen zu verhindern.
Zunächst steigen wir in den globalgeschichtlichen Kontext Britisch-Indiens und des Deutschen Kaiserreichs ein und skizzieren die Verflechtung der kolonialen Infrastruktur beider Regionen. Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns sodann auf die Präsenz von Inder:innen in Berlin und beschreiben die Rahmenbedingungen ihres Ankommens und Lebens bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Diese Abschnitte verfolgen eine vorrangig chronologische Argumentation und beziehen sich größtenteils auf indische Studierende und Kriegsgefangene. Mit Virendranath Chattopadhyaya stellen wir einen Aktivisten im Kontext der indischen Selbstorganisierung in Berlin zentral vor. Nach einer Skizzierung des globalgeschichtlichen Rahmens koreanischer Migration führen wir die chronologische Erzählung anhand der Biografie von An Pong-gŭn fort, um so die Rahmenbedingungen und Vielschichtigkeit von koreanischen Präsenzen in Deutschland und Berlin zu erzählen. Hieran schließt sich eine nähere Betrachtung des Olympiasiegs und Aufenthalts von dem Läufer Son Ki-jŏng in Berlin zu Zeiten des deutschen Nationalsozialismus an. Die asynchrone Anordnung der indischen und koreanischen Biografien soll den konkreten Vergleich vermeiden, um so automatisierten Rückschlüssen und Kategorisierungen vorzubeugen, sowie Perspektiven auf Strukturen Berlins sowie die verräumlichten Begegnungsmöglichkeiten in den Fokus rücken. Daran anknüpfend gehen wir mit dem Büro der Liga gegen Imperialismus auf einen Begegnungsraum in Berlin-Kreuzberg ein und weiten den Blick auf den Brüsseler Kongress, wo wir uns auf die Aktivitäten der koreanischen und indischen Delegierten konzentrieren. Anschließend wenden wir uns erneut dem Berliner Raum zu und suchen nach den wenigen Hinweisen von Cross Asian Encounters.
Indische Präsenzen in Berlin
Der europäische Kolonialismus hatte auf dem indischen Subkontinent eine lange Geschichte: Während ab dem 15. Jahrhundert portugiesische Kolonialmächte tätig waren, kamen im 17. Jahrhundert niederländische, britische, dänisch-norwegische und französische koloniale Unternehmungen auf dem indischen Kontinent hinzu. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden lokale Imperien auch durch den Eingriff europäischer Mächte destabilisiert, sodass im späten 18. Jahrhundert vor allem britische und französische Kolonialmächte um die Dominanz vor Ort kämpften. Mit der Niederschlagung des Indischen Aufstandes von 1857 durch die Engländer wurde Britisch-Indien gegründet und die britische Vorherrschaft offiziell deklariert. Britisch-Indien umfasste zur Zeit seiner größten Ausdehnung nicht nur das Territorium der heutigen Republik Indien, sondern auch die Territorien der heutigen Staaten Pakistan, Bangladesch und Myanmar.
Das Deutsche Kaiserreich und Britisch-Indien unterhielten im 19. Jahrhundert einen regen Austausch. Auch wenn das Deutsche Kaiserreich erst ab 1884 offiziell als Kolonialmacht tätig wurde und ihr politischer Wirkungsgrad nie offiziell mit Britisch-Indien verbunden war, waren etwa deutsche Unternehmer:innen, Wissenschaftler:innen und Künstler:innen Teil der kolonialen Infrastruktur. Wissenschaftler:innen beforschten indische Kulturen, Künstler:innen vermittelten Bilder von Indien und Unternehmer:innen waren in Britisch-Indien wirtschaftlich[3] tätig. Obwohl die Reiserichtung bis zum Ersten Weltkrieg von Deutschen nach Britisch-Indien überwog, nutzten dennoch einige Inder:innen die Ausbildungsmöglichkeiten in der deutschen Metropole und kamen etwa zum Studium oder für ein Praktikum in einem industriellen Betrieb nach Berlin. Indische Gelehrte wiederum folgten dem deutschen Interesse an der indischen Kultur und bereisten auf ihren Vortragsreisen das Deutsche Kaiserreich. Als Teil von sog. Völkerschauen waren indische Artist:innen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in deutschen Zoos, Parks und auf Volksfesten präsent. Die folgenden Abschnitte beleuchten diese kolonialen Verstrickungen tiefergehender und skizzieren zugleich den Wandel angesichts global-politischer Zäsuren.
1870–71 bis zum Ersten Weltkrieg: Berlin als Studienstandort
Schon vor der Reichsgründung 1870⁄71 bestand ein wissenschaftliches Interesse deutscher Indolog:innen, Ethnolog:innen, Archäolog:innen an indischen Kulturen. Die Reisen deutscher Wissenschaftler:innen nach Indien brachten wiederum Artefakte und alte Manuskripte für Museen und Bibliotheken nach Berlin[4]. Auch die Einrichtung des Hindustani-Sprachstudiums am 1887 gegründeten “Seminar für Orientalische Sprachen”[5] in Berlin zeugte vom deutschen Interesse am indischen Kontinent. Mediziner wie Robert Koch wiederum reisten im staatlichen Auftrag nach Indien, u.a. 1883 zur Erforschung von Cholera sowie 1897 zur Erforschung der Beulenpest im heutigen Mumbai (vgl. Günther & Rehmer 1999: 27).
Während nun deutsche Wissenschaftler:innen nach Britisch-Indien reisten und das sich so erworbene Wissen im Deutschen Kaiserreich verbreitete, traten ebenso indische Studierende den Reiseweg Richtung Berlin an: 1873 studierte und wohnte A.J. Ebel, vermutlich ein Inder aus dem angelsächsischen Raum, in der Königgrätzer Straße 54 (heute Stresemannstraße, Kreuzberg). Ramchandar Pradan wohnte von 1874 bis 1878 in der Oranienburger Straße 2 sowie Unter den Linden 57. Beide studierten Philologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Die 1809 gegründete Einrichtung genoss unter ausländischen Studierenden einen guten Ruf. Für Studierende von Ingenieurberufen kam die 1879 gegründete Königlich-Technische Hochschule in Charlottenburg hinzu, der heutigen Technischen Universität. An der Charité, der Universitätsklinik, lehrten namhafte Mediziner:innen wie Rudolf Virchow oder der schon erwähnte Robert Koch – und trugen so auch dazu bei, dass Berlin als Studienstandort für indische Studierende an Attraktivität zunahm.
Der Erste Weltkrieg: Politische Organisierung in Berlin
Der Beginn des Ersten Weltkriegs brachte eine Zäsur für die Berlin lebenden Inder:innen: In Berlin und Umgebung blieben einige Studenten, die der Krieg überrascht hatte. Hinzu kamen neue, politisch engagierte Studierende, indische Freiheitskämpfer sowie indische Kriegsgefangene. Berlin wurde zum Zentrum der indischen Aktivitäten gegen Großbritannien.
Die militärische Aufrüstung im Ersten Weltkrieg führte auch zur Verpflichtung von Menschen aus den jeweiligen kolonialen Kontexten, für das Heer der Kolonialmacht zu kämpfen. So gelangten neben französischen Kolonialsoldaten auch die des britischen Heeres in deutsche Kriegsgefangenschaft. Dabei waren muslimische Kolonialsoldaten von besonderem Interesse für die preußische Regierung: In Absprache mit dem Osmanischen Reich als Kriegsverbündeten bestand die Absicht, Muslim:innen gegen “ihre” französischen und britischen Kolonialmächte aufzuwiegeln. So ließ das Deutsch Kaiserreich Ende 1914 das Kriegsgefangenenlager Wünsdorf südwestlich von Berlin vorrangig erbauen, um muslimische Kriegsgefangene zu internieren. Die deutsche Strategie sah auch vor, die muslimischen Kriegsgefangenen durch eine bevorzugte Behandlung für den Kampf gegen die britischen und französischen Kolonialmächte zu überzeugen – etwa mittels des Rechts zur freien Religionsausübung. So wurde im Juli 1915 eine Moschee eröffnet, die dem Lager den Beinamen “Halbmondlager”[6] einbrachte. Einige der muslimischen Kriegsgefangenen stammten vom indischen Subkontinent. Unter ihnen befanden sich auch Sikhs und Hindus.
Die propagandistische Beeinflussung scheint rückblickend wenig Erfolg für die deutsche Seite gehabt zu haben: Von den insgesamt 16.000 Kriegsgefangenen in Zossen und Wünsdorf liefen nur circa 1800 über (vgl. Liebau 2015). Jedoch wurde die Nähe der Menschen aus kolonialen Kontexten zur Kolonialmetropole von Anthropolog:innen und Ethnolog:innen Berlins für ihre Zwecke ausgenutzt, wovon akribische Schädelvermessungen und Audio-Aufnahmen der Kriegsgefangenen in ihren jeweiligen Sprachen und Dialekten zeugen. Die individuellen Geschichten der Kriegsgefangenen lassen sich nur beschwerlich rekonstruieren[7]. 1917 wurden alle indischen und ein Großteil der afrikanischen Gefangenen nach Rumänien in von Deutschland besetzte Gebiete verlegt. Zahlreiche Kriegsgefangene hatten zuvor den Winter in Brandenburg nicht überlebt. Noch heute zeugen die Grabstätten von 206 Indern auf dem Friedhof bei Zehrensdorf, unweit von Wünsdorf, von ihrer Präsenz (vgl. Oesterheld & Günther 1997).
Die Anwesenheit der indischen Kriegsgefangenen im Berliner Umland wurde indes auch von den indischen antikolonialen und nationalistischen Aktivisten, die sich zunehmend seit Beginn des Ersten Weltkriegs in Berlin aufhielten, wahrgenommen und in ihr politisches Handeln einbezogen. Einer der bemerkenswertesten Aktivisten war Virendranath Chattopadhyaya, auch Chatto genannt (vgl. Barooah 2004).
Chatto selbst kam aus einer intellektuellen Brahmanen-Familie der bengalischen Region. Sein Studium begann er in Madras und Kalkutta, bevor er 1902, wie auch zahlreiche andere nationalistisch eingestellte indische Studierende, in die Kolonialmetropole London ging und sich neben seinem Jura-Studium verstärkt in sozialistischen und sozialdemokratischen Kreisen aufhielt. Da die staatlichen Repressionen in London gegen indische Aktivist:innen zunahmen, verlegte Chatto sein Handeln 1910 in die Kolonialmetropole Paris. Hier erhoffte er sich Vernetzung mit anderen antikolonialen Aktivist:innen, ohne dem Druck der britischen Kolonialmacht ausgesetzt zu sein (vgl. Liebau 2017). Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs und der sich abzeichnenden Allianz zwischen den Entente-Mächten Frankreich und Großbritannien zog Chatto nach Deutschland und schrieb sich an der Universität Halle für Vergleichende Literaturwissenschaften ein. Schon im September 1914 zog er nach Berlin und gründete gemeinsam mit seinem indischen Kommilitonen Abinash Bhattacharya das Indische Unabhängigkeitskomitee[8] mit einem Büro in der Charlottenburger Wielandstraße 38.
Unterstützt wurde das Indische Unabhängigkeitskomitee durch die sog. Nachrichtenstelle für den Orient. Die 1914 vom Auswärtigen Amt gegründete Behörde mit Sitz in Charlottenburg hatte zum Ziel, durch Propaganda-Aktivitäten die Mittelmächte zu destabilisieren. Teil dessen war u.a. die Publikation von Zeitschriften in Hindi, Urdu, Persisch oder Türkisch, die im Ausland verteilt wurden oder als Lagerzeitschriften in Wünsdorf zirkulierten. Neben deutschen Beamten arbeiteten indische Studierende, Sprachlektoren des oben erwähnten“Seminar für Orientalische Sprachen” wie auch Internierte des Kriegsgefangenenlagers für die Nachrichtenstelle (vgl. Manjapra 2014). Zugleich nutzten die indischen Aktivist:innen das Wissen und die Ressourcen ihrer Anstellung, um ihren antikolonialen Kampf voranzutreiben. Chatto sah sich darin selbst als Botschafter zwischen den Tätigkeiten des Indischen Unabhängigkeitskomitees und der Nachrichtenstelle (vgl. Liebau 2017).
Das Komitee betrachtete sich als provisorische Exilregierung eines freien Indien, was besonders prägnant darin wurde, als es im Juli 1915 den Kriegszustand mit Großbritannien verkündete. Die entsprechende Erklärung endete mit den Worten: “Wir haben ein Recht für die Freiheit zu kämpfen und werden nicht aufhören, bis Indien frei ist” (zit. nach Lothar und Rehmer 1999: 56). Neben Stellungnahmen dieser Art gingen vom Komitee in Kooperation mit der Nachrichtenstelle auch Sabotageakte aus, wie etwa am Suezkanal. Mit türkischer Unterstützung, vermittelt durch das Auswärtige Amt, sollte der Waffennachschub an der britischen Westfront nach Australien und Indien unterbunden und somit auch die britische Kolonialherrschaft in Indien geschwächt werden. Diese und andere Aktionen zeigten jedoch nicht den erhofften Wirkungsgrad. Als Ende 1917 die finanzielle Unterstützung durch das Auswärtige Amt versiegte, löste sich das Indische Unabhängigkeitskomitee auf (ebd.: 57). Jawaharlal Nehru, der in den 1910er Jahren in Berlin zu Besuch war, Mitglied der indischen Delegation beim Brüsseler Kongress sein wird und später der erste Ministerpräsident des unabhängigen Indiens werden würde, schrieb dazu:
“Der Krieg ging zu Ende, und damit auch das indische Komitee in Berlin. Das Leben hatte sich für die Mitglieder, deren Hoffnungen nun zerschellt waren, verdüstert. Sie hatten um hohe Einsätze gespielt und verloren … die Inder durften nicht in ihre Heimat zurückkehren, und das besiegte Deutschland nach dem Kriege bot keinen angenehmen Aufenthaltsort. Einigen von ihnen wurden später von der britischen Regierung die Rückkehr nach Indien gestattet, doch viele mußten bleiben, in recht eigenartiger Lage. Sie waren staatenlos; sie hatten keine Pässe. Es war kaum möglich, außerhalb Deutschlands zu reisen, sogar der Aufenthalt innerhalb Deutschlands bot Schwierigkeiten und hing ganz von der Ortspolizei ab. Es war ein Leben in der Unsicherheit und Not, ein Leben ständiger Sorgen um den Lebensunterhalt.” (zit. nach Oesterheld & Günther 1997: 15f).
Nehrus Aufzeichnungen verdeutlichen die prekäre Lage von Inder:innen in Berlin kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs. Britisch-indische Staatsangehörige wurden staatenlos, als ihnen die Pässe aufgrund ihrer politischen Aktivitäten entzogen wurden. Einige schrieben sich daraufhin erneut an den Berliner Universitäten ein, was ihren Aufenthalt für kurze Zeit legitimierte (Lothar & Rehmer 1999). Andere verlagerten ihre politischen Aktivitäten in die entstehende Sowjetunion, die sich als neuer Antagonist auf der imperialen Weltkarte zu Großbritannien entwickelte. Auch Chatto hatte zum Ende des Kriegs während einiger Aufenthalte im neutralen Schweden Kontakte mit der Kommunistischen Internationalen geknüpft, die sich ihm und seinen Mitstreiter:innen später für die politischen Kämpfe als nützlich erwiesen haben werden werden, wie wir weiter unten aufgreifen werden.
Koreanische Präsenzen in Berlin
Um die Geschichte von Koreaner:innen[9] in Berlin erzählen zu können, muss zunächst sehr kurz der geschichtliche Kontext und der koloniale Hintergrund Koreas erläutert werden. Nachdem Korea 1905 zu einem Protektorat von Japan geworden war, wurde es 1910 offiziell von Japan annektiert und zur japanischen Kolonie, nachdem der Unabhängigkeitskämpfer An Chung-gŭn[10] den japanischen Generalgouverneur Itō Hirobumi erschossen hatte.[11] Es folgten starke Repressionen und die Unterdrückung jeglicher politischer Aktivität in Korea. Im März 1919 entstand unter anderem als Reaktion auf das Ende des Ersten Weltkrieges und die Äußerungen Woodrow Wilsons, dem damaligen US-amerikanischen Präsidenten, zum Selbstbestimmungsrecht der Völker eine große Protestbewegung. Diese sogenannte Bewegung des ersten Märzes, die sich in ganz Korea ausbreitete, wurde jedoch brutal vom japanischen Militär und der japanischen Polizei niedergeschlagen. Als Konsequenz flohen viele Koreaner:innen ins Ausland. In Shanghai wurde eine Exilregierung gegründet.
Die Familien der koreanischen Elite schickten ihre Kinder zum Studieren oft an japanische Universitäten, doch ab dem Anfang der 1920er Jahre auch immer häufiger in die USA und nach Europa (vgl. Hoffmann 2015: 12). Die Studierenden waren nicht als Koreaner:innen an den Universitäten eingeschrieben, sondern als japanische Bürger:innen. In den 1920er und 1930er Jahren konnten sie daher ohne Visa nach Deutschland einreisen (vgl. Lee and Mosler 2018: 34). Andere Koreaner:innen verließen Korea aus politischen Gründen. Oftmals flohen sie ins chinesische Exil. In Shanghai konnten sie einen Pass von der chinesischen Regierung ausgestellt bekommen und weiter nach Europa reisen (vgl. Hoffmann 2015: 12f.). Auch Berlins Status als offene Metropole, in der sich Menschen verschiedenster politischer Gruppierungen sammelten, dürfte die Stadt für viele von ihnen interessant gemacht haben (vgl. Yu-Dembski 2007: 40, Kuck 2014: 158). Koreaner:innen waren vorrangig als Studierende, Wissenschaftler:innen oder Künstler:innen in Berlin und stammten aus gutsituierten Familien. Anders als bei Chines:innen in Berlin[12] gibt es keine Berichte darüber, dass koreanische Arbeiter:innen in Berlin präsent waren und sich eine entsprechende Trennung verschiedener koreanischer Bevölkerungsgruppen im Stadtbild abbildete.
In den 1920er Jahren lebten etwa 60 Koreaner:innen in Deutschland, 40 von ihnen in Berlin (vgl. Lee and Mosler 2018: 48). Konkrete Zahlen zu bestimmten Jahren lassen sich schwer nachvollziehen, da die Koreaner:innen nicht als solche erfasst wurden. Auch deswegen stellt Frank Hoffmanns Buch Berlin Koreans and Pictured Koreans einen wichtigen Einschnitt in die bisherige Forschungslage zu Koreaner:innen in Berlin dar, weil es unter anderem einen ausführlichen Überblick über koreanisches Leben in Berlin gibt. Im ersten Teil des Buches beschreibt Hoffmann detailliert die Biografien von verschiedenen Koreanern, die zeitweilig in Berlin gelebt haben. Basierend auf seinen Nachforschungen wird nachfolgend beispielhaft die Biografie von An Pong-gŭn besprochen, um die Rahmenbedingungen der Leben der Koreaner:innen in Deutschland und Berlin zu beschreiben und die vielen Ambivalenzen und komplexen Verstrickungen ihrer Präsenzen aufzuzeigen.
An Pong-gŭn: Ein koreanischer Migrant mit vielen Rollen
An Pong-gŭn war Mitglied einer einflussreichen Familie und Cousin des wohl größten koreanischen Nationalhelden, dem schon zuvor erwähnten politischen Attentäter An Chung-gŭn. Er kam das erste Mal 1914 nach Deutschland, zusammen mit dem benediktinischen Missionar Vater Wilhelm, der der katholischen Familie An verbunden war. Es lag zu dieser Zeit im nationalen deutschen Interesse, Koreaner:innen zu helfen und sie in ihrem Unabhängigkeitskampf zu unterstützen, da Japan im Ersten Weltkrieg mit Großbritannien verbündet war. Gleichzeitig benutzen An und andere Koreaner:innen die europäischen Missionare als ihr Ticket nach Europa (vgl. Hoffmann 2015: 20f.).
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden japanische Staatsbürger:innen in Deutschland in Schutzhaft genommen und in Polizeigefängnissen festgehalten. An Pong-gŭn, der wegen Koreas Kolonialstatus als japanisches Subjekt galt, saß fünf bis sechs Wochen in Kaiserslautern im Gefängnis, wo er hungerte und fast zu Tode geschlagen wurde (vgl. ebd.). Nur durch die Bemühungen der Missionare kam er frei. Er begann Deutsch zu lernen und bereitete sich auf ein Studium als Maschinenbauingenieur vor. Das Elend des Ersten Weltkrieges ließ ihn die Entscheidung fassen, über die Niederlande nach Korea zurückzukehren. Doch sobald er die niederländische Grenze überquerte, wurde er festgenommen und von der japanischen Botschaft festgehalten, die über alle Koreaner:innen in Europa informiert war. Ihm wurde Spionage für die Deutschen vorgeworfen und er wurde unter Gewalteinwirkung von japanischen Polizeiagenten erst nach Japan und schließlich nach Korea gebracht (vgl. ebd.: 25). An wurde in Europa und Deutschland situationsabhängig sowohl als japanisch als auch als koreanisch angesehen.
Jahre später kehrte An über das Exil in Shanghai und mit Hilfe der Benediktiner nach Europa zurück. Es ist unklar, wo er zu Beginn der 1920er lebte, doch ist bekannt, dass er Bildungsarbeit für die koreanische Sache betrieb: Er arbeitete als Experte für das Völkerkunde-Museum in Dresden, veröffentlichte eine Kurzgeschichte und Artikel über das koreanische Schulsystem, produzierte Radiosendungen über Korea und arbeitete für Martin Heydrich (ein Anthropologe, der später führender Kopf der nationalsozialistischen Rassenideologie wurde) an einem Buch über koreanische Agrarwirtschaft (vgl. ebd.: 26ff.). Frank Hoffmann stellt die Vermutung an, dass An Pong-gŭn sich auf dem linken politischen Spektrum befand. So war er zum Beispiel als Kontaktperson für Korea in der Zeitschrift Proletarische Sozialpolitik, herausgegeben von der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) von 1928 bis 1933, gelistet. Dass dies eigentlich im Gegensatz zu seinem Katholizismus stand, demonstriere, so Hoffmann, dass politische Ideologien und Religion für koreanische Aktivist:innen in erster Linie Instrumente waren, um für die koreanische Unabhängigkeit zu kämpfen (vgl. ebd.: 29).
An Pong-gŭns Präsenz in Berlin ging jedoch über wissenschaftliches Arbeiten oder politischen Aktivismus hinaus. Spätestens mit der Machtergreifung Hitlers war sozialistischer, kommunistischer und politischer Aktivismus in Berlin nicht mehr möglich. An blieb in Berlin und suchte sich ein neues Standbein: Er baute eine Tofufabrik auf. Er verdiente gutes Geld damit, Tofu für die asiatischen Studierenden in Berlin zu produzieren und importierte Waren zu verkaufen. Er zog von Kreuzberg nach Charlottenburg in die Kantstraße, damals dominiert von wohlhabenden Chines:innen (vgl. ebd.: 30). Später spielt er in diversen deutschen Spielfilmen mit – u.a. 1939 als “indischer” Charakter, dem Tierwärter “Shing”, im Film Männer müssen so sein[13] (vgl. ebd.: 34).
Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, verließen die meisten der wenigen japanischen und koreanischen Menschen, die nach Hitlers Machtergreifung in Berlin geblieben waren, die Stadt. Einige, darunter An, blieben jedoch zurück. Frank Hoffmann spekuliert, dass An sogar mit den Nazis kollaboriert haben könnte: So finde sich ein Hinweis darauf, dass An nach den Olympischen Spielen Sachverständiger für Sojabohnenanbau in Deutschland geworden sei (vgl. ebd.: 36). Die letzten Jahre des Krieges lebte An in Italien. Auf seiner Reise 1945 zurück nach Korea erkrankte er schon in Italien und verstarb letztendlich dort (vgl. ebd.: 37).
An Pong-gŭn nahm in seinem Leben in Deutschland viele verschiedene Rollen ein, von Kulturvermittler bis Staatsfeind, Wissenschaftler, Autor, Schauspieler, politischem Aktivist und Anhänger eines benediktinischen Ordens. Sein bewegtes Leben zeigt, dass der Status, den er als Koreaner innehatte, stetig im Wandel war und seine Behandlung durch den deutschen Staat und die deutsche Gesellschaft, abhängig vom momentanen politischen Klima stark variierte. Seine Rollen waren zum Teil fremdzugeschrieben – zum Beispiel wenn er als japanisches Subjekt interniert wurde – doch oftmals auch von ihm gewählt. Natürlich war er in seinen Entscheidungen nicht vollkommen frei – so musste er sich seine Lebensgrundlage als Ausländer und Exilant in Berlin sichern. Doch lässt seine Biografie darauf schließen, dass er durchaus eigenmächtig handelte und seinen verschiedenen Interessen aktiv nachging. Dabei begegnete er auch immer wieder anderen Koreaner:innen und Menschen vom asiatischen Kontinent. Seine Wohnung in der Kantstraße war umgeben von chinesischen Restaurants und Geschäften der chinesischen Mittel- und Oberklasse in Berlin und seine Wohnung scheint ein Mittelpunkt der koreanischen Community in Berlin gewesen zu sein: So waren etwa die koreanischen Mitglieder der japanischen Olympiamannschaft mehrfach zum Essen bei An zu Gast (vgl. Hoffmann 2015: 31). Einer von ihnen war der Gewinner des Olympischen Marathons von 1936, Son Ki-jŏng.
Son Ki-jŏng: Ein Olympiasieger unter falscher Flagge im Nationalsozialismus
In der Glockenturmstraße, nahe dem Olympiastadion, findet sich eine Bronzestatue von einem Läufer. Dieser Läufer ist Son Ki-jŏng[14], Olympiasieger im Marathon von 1936. Auf den Steintafeln am Olympiastadion, die alle Namen der Gewinner:innen aufführen, liest man “Marathonlauf 42195m Son Japan”. Denn der Koreaner Son war gezwungen, unter japanischer Flagge bei den Olympischen Spielen anzutreten, da Korea zu diesem Zeitpunkt eine Kolonie Japans war.[15] Son Ki-jŏng wird auch als “traurigster Olympiasieger aller Zeiten” betitelt: Während der Siegerehrung wendete er seinen Blick von der japanischen Flagge ab und senkte seinen Kopf. Den Eichen-Schößling, welchen die Sieger überreicht bekamen, platzierte er vor der japanischen Flagge auf seinem Trikot (vgl. Spannagel 2016). Während seiner Zeit in Berlin weigerte er sich, mit seinem japanischen Namen zu unterschreiben und benutzte stattdessen seinen koreanischen Namen (vgl. ebd.). Später wird er sagen: “Ich bin nicht für die Japaner gelaufen. Ich bin für mich gelaufen. Und für mein geschundenes Volk.” (vgl. ebd.). In Korea wurde sein Foto in einer großen Tageszeitung abgedruckt und die japanische Flagge auf seinem Trikot wegretuschiert. Als Konsequenz wurde die Zeitung verboten und die Angestellten schwer bestraft (vgl. Podoler 2021). Son Ki-jŏng wurde so zur Symbolfigur des koreanischen antikolonialen Widerstands.
Dass ausgerechnet Nazi-Deutschland zur Bühne von Son Ki-jŏngs anti-kolonialem Protest wurde, lässt innehalten und hinterfragen: Wie wurde Son in der deutschen Gesellschaft und in den deutschen Medien wahrgenommen? Was lässt sich von seiner Präsenz in Berlin und seiner Behandlung auf den Status von anderen Menschen vom asiatischen Kontinent in Deutschland und Berlin in den Zeiten des Nationalsozialismus schließen?
Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin sind wohl die kontroversesten Olympischen Spiele der Moderne. Im Vorfeld wurde über mehrere Jahre ein Boykott diskutiert. Im Nachhinein wurde an vielen Stellen diskutiert, ob die Olympischen Spiele ein Triumph für die Nationalsozialisten waren oder ob die Siege des afroamerikanischen Leichtathleten Jesse Owens[16] und von Son Ki-jŏng Momente der Subversion und Widerlegung der Nazi-Ideologie darstellten (vgl. Guttmann 2006: 65). Mittlerweile sind sich die meisten Historiker:innen zumindest in einem Punkt einig: Die Olympischen Spiele 1936 ermöglichten es den Nationalsozialisten, einen falschen Eindruck von ihrem Régime in der Welt zu verbreiten, indem weder Nationalismus noch Rassenideologie während der Spiele betont wurden (vgl. ebd.: 73). Während und vor den Olympischen Spielen wurde es der Presse verboten, übermäßig antisemitische oder rassistische Inhalte zu veröffentlichen. Es durfte weder abwertend über Schwarze Menschen (afroamerikanische Sportler:innen aus den USA) noch über Jüd:innen geschrieben werden. Zeitungen, die sich an diese Vorgabe nicht hielten, wurden bestraft. Auch Anfeindungen in der Öffentlichkeit wurden zu verhindern versucht (vgl. Krüger 2003: 24f.).[17]
Son Ki-jŏng wurde in den deutschen Medien nicht als Koreaner identifiziert, sondern stets als Japaner bezeichnet (vgl. Law 2009: 178). Es ist unklar, ob dies aus Absicht oder Ignoranz geschah. Die Berichterstattung über ihn und andere Athlet:innen, die unter japanischer Flagge antraten, war von Stereotypen geprägt – so wurden die Athlet:innen, auch wenn sie sich in ihrer Statur nicht wesentlich von europäischen Sportlern unterschieden, oft als “zierlich” oder “klein” betitelt (vgl. ebd.: 172). In einem Bericht über den Marathonlauf in einem Zigarettenbildersammelalbum heißt es:
“Klein und leicht, begabt mit einem außergewöhnlich ergiebigen Schritt, der locker und ungekünstelt stundenlang beibehalten werden kann, bringt Son für diesen Langstreckenkampf die ganze Zähigkeit seiner Rasse mit. Die unerschöpfliche Geduld, die immer wieder bereit ist, neue und schwere Strapazen auf sich zu nehmen, die traditionsmäßige und vorbildliche Willensschulung der Japaner, bilden die Grundlagen der zielbewußt seit 1928 angestrebten Erfolge.” (Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld 1936: 55)
Diese Beschreibung deutet darauf hin, dass die deutsche Öffentlichkeit ein gewisses Bild und Verständnis von ostasiatischen Menschen hatte, das in den Medien reproduziert wurde.[18] Son Ki-jŏng und Jesse Owens der gleichen Kategorie zuzuordnen, da beide nicht “arisch” waren, greift jedoch zu kurz und wird der Komplexität der Konstruktion von Rasse im Nationalsozialismus nicht gerecht.
Schon vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten schwankte die Wahrnehmung der Deutschen von Japan zwischen Angst und Faszination. So wurde Japans expansionistische Kolonialpolitik im Deutschen Kaiserreich mit Sorge, aber auch Bewunderung betrachtet: Kaiser Wilhelm II warnte vor der “Gelben Gefahr” (Law 2019: 10). Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten änderte sich die öffentliche Darstellung von Japan noch einmal gravierend, denn Japaner:innen hatten einen Sonderstatus in der nationalsozialistischen Ideologie: Sportliche, militärische und diplomatische Errungenschaften Japans wurden glorifiziert und die “rassische Reinheit” ihrer Gesellschaft gelobt (vgl. ebd.: 298). 1945 bezeichnet Hitler Japan und China sogar als ebenbürtig und betont ihre lange Kulturgeschichte (vgl. Krebs 2015: 240). Auch der Koreaner Son Ki-jŏng profitierte daher von seinem offiziellen Status als Japaner. Das japanische Olympiateam wurde bewundert für seine Erfolge.
Trotz ihres Sonderstatus waren Japaner:innen dennoch offiziell nicht-arisch, sodass auch Ehen zwischen Deutschen und Japaner:innen verboten werden sollten. Dies stellte ein großes diplomatisches Problem für Deutschland und Japan, die Verbündete waren, dar und es wurden diverse absurde Verrenkungen vorgenommen, um einerseits die nationalsozialistische Rassenideologie beizubehalten und andererseits den japanischen Verbündeten nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. 1933 wurde zum Beispiel nach Beschwerde des japanischen Außenministeriums die Bezeichnung “Gelbe Gefahr” und das Wort “gelb” als Beschreibung von Japaner:innen durch das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda verboten (vgl. Krebs 2015: 219f.).
Nach Hitlers Machtergreifung gingen dennoch, wie zuvor erwähnt, die Zahlen ostasiatischer Studierender in Berlin rapide zurück. Politische Aktivitäten wurden verboten, das Klima gegen Menschen vom asiatischen Kontinent verschlechterte sich und rassistische Ressentiments wurden offen ausgelebt. Besonders Chines:innen waren, nachdem China dem Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten beigetreten war, gewaltvoller Verfolgung ausgesetzt.[19] Doch einige ostasiatische Menschen – so auch eine Zahl von Koreaner:innen[20] – blieben und konnten teilweise bis zum Kriegsende im nationalsozialistischen Deutschland leben (vgl. Hoffmann 2015: 34, Law 2019: 297). Diese Erfahrung unterscheidet sich maßgeblich von der aktiven Verfolgung, die Jüd:innen, Sinti:zze und Rom:nja und Schwarze Menschen in Deutschland erlebten.
Manche Koreaner waren sogar aktive Kollaborateure des nationalsozialistischen Regimes und hatten sich vollends der nationalsozialistischen Ideologie verschrieben. Dazu zählen unter anderem der Komponist An Ik‑t’ae und der Tänzer Kuni Masami (vgl. Hoffmann 2015: 117), sowie der Eugeniker Kim Paek‑p’yŏng, der am Kaiser Wilhelm Institut für Anthropologie in Dahlem als “Schädelspezialist” arbeitete und dessen Mentor Eugen Fischer, ein führender Rassentheoretiker des Nationalsozialismus, war (vgl. ebd.: 137ff.). Son Ki-jŏngs Einstellung zu Deutschland und dem Nationalsozialismus ist nicht bekannt. Jedoch pflegte er eine langjährige Freundschaft mit der umstrittenen Filmemacherin Leni Riefenstahl,[21] in deren Dokumentarfilm über die Olympischen Spiele er eine wichtige Rolle einnahm (Guttmann 2006: 74).
Community-übergreifende Begegnungen im Berlin der Weimarer Zeit
Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Abschluss des Versailler Vertrags veränderte sich auch die Wahrnehmung der Welt von Deutschland. Das Deutsche Kaiserreich hatte den Krieg verloren und musste zugleich auch die Kolonialgebiete abtreten. Antikoloniale Aktivist:innen erschien die ehemalige Kolonialmetropole Berlin nun als “neutraler” Ort, von dem aus eine politische Vernetzung zum Kampf gegen die Kolonialmächte organisiert werden konnte. Das liberale Prinzip der nationalen Selbstbestimmung gewann an Beachtung und gleichzeitig befeuerte der Aufstieg der Sowjetunion und des marxistisch-leninistischen Kommunismus anti-koloniale Bestrebungen. Es gab immer mehr Menschen, die aus den Kolonien nach Europa kamen, sich organisierten und untereinander austauschten, sodass auch Verbindungen zwischen Kolonialmigrant:innen verschiedener Herkunft entstanden. Berlin wurde in dieser Zeit also zu einem temporären Zuhause für antikoloniale Bewegungen. Dies hatte neben den bereits genannten Umständen auch andere praktische (gute Universitäten), wirtschaftliche (hohe Inflation und günstige Lebenshaltungskosten) und politische (Deutschlands Unterstützung von antikolonialen Bewegungen gegen Großbritannien und die Stärke der Kommunistischen Partei Deutschlands) Gründe. Zudem ernannte die Kommunistische Internationale (Komintern) Berlin zum Zentrum antikolonialer Aktivitäten außerhalb der Sowjetunion. Chinesische, indische und arabische Studierende und Aktivist:innen stellten die größten Gruppen unter den Kolonialmigrant:innen dar (vgl. Kuck 134 ff).
In den 1920er Jahren kamen auch viele junge Koreaner:innen als Studierende nach Deutschland, die durch die Bewegung des ersten Märzes politisiert worden waren, und engagierten sich politisch. 1921 wurde die Koryŏ Studentenvereinigung[22] in Deutschland gegründet. Der Studierendenverband hatte seinen Sitz in der Kantstraße, unweit der Büros des deutlich größeren, ebenfalls antikolonial ausgerichteten, chinesischen Studierendenverbandes.[23] Im Oktober 1923 organisierten die koreanischen Studierenden einen Protest gegen die japanische Regierung als Antwort auf ein Massaker an Koreaner:innen. Zu diesem Anlass wurden bis zu 7.000 Exemplare eines zweiseitigen Flugblattes mit dem Titel “Japans blutige Herrschaft in Korea” (“Japan’s Bloody Rule in Korea”) auf Deutsch, Englisch und Chinesisch gedruckt (vgl. Hoffmann 2015: 60f.). Der Druck in verschiedenen Sprachen und der Standort der Büroräume lassen darauf schließen, dass die koreanischen Aktivist:innen mit anderen linken Studierenden vernetzt waren und zusammenarbeiteten.
Auch auf indische Menschen übte die ehemalige Kolonialmetropole Berlin mit seinem Ruf als “neutraler Ort” einen Reiz aus: Indische Studierende gingen in den 1920ern wieder vermehrt an die Berliner Universitäten, und auch Ausbildungsorte wie die Industrieunternehmen von AEG, Siemens oder Schering waren wieder reizvoll um den Fachkräftemangel in den industrialisierten Zweigen Indiens abzudecken (vgl. Oesterheld 2004: 191ff). Die steigende Präsenz von Inder:innen im Berlin der 1920er wurde begleitet von zahlreichen Neugründungen indischer Selbstorganisationen. Diese Vereinigungen dienten einerseits zur Vernetzung von Inder:innen im Exil, boten Unterstützung im Alltag an und ermöglichten andererseits politische Mobilisierung. Nicht selten waren ihre Mitglieder in mehreren Vereinigungen aktiv. Hervorzuheben ist der 1922 gegründete “Verein der Inder in Zentraleuropa”[24], der u.a. mit einem umfangreichen Kulturprogramm die indische Geschichte dem Berliner Publikum näher brachte. So lud der Verein die Berliner Öffentlichkeit etwa zu einem Tee-Abend mit der indischen Dichterin und Feministin Sarojini Naidu, dessen Bruder der oben erwähnte Chatto war[25]. Diese Abende waren zugleich auch Anlass für Community-internen Austausch. Aber auch verschiedene politische Organisationen des antikolonialen Spektrums kamen auf Initiative des Vereins zusammen, wie bspw. antikolonial aktive Ägypter:innen (vgl. Günther & Rehmer 1999: 163ff).
Auch Chatto wurde wieder im Berlin der Weimarer Zeit politisch tätig und prägte somit die politische Mobilisierung von indischen Menschen in Berlin entscheidend mit. So gründete er etwa 1921 das in Halensee ansässige “Indische Nachrichten- und Informationsbüro”[26]. Getragen vom Indischen Nationalkongress unterstützte das Büro indische Studierende in organisatorischen Belangen wie Visaangelegenheiten, Einschreibungsformalitäten und vermittelte Praktika in Berliner Betriebe. Eine weitere Aufgabe des Büros bestand darin, deutsche wie auch indische Medien mit unabhängigen Nachrichten zu versorgen (vgl. Oesterheld 2004: 191 ff). Selbstorganisationen wie diese ermöglichten die Vernetzung von Menschen des indischen Subkontinents innerhalb Berlins und erlaubten im Bedarfsfall eine rasche Mobilisierung für den Protestfall. Dies geschah etwa gegen die sog. Indienschau von 1926 im Berlin Zoo. Der Halbbruder Carl Hagenbecks, John Hagenbeck, war im Sommer 1926 mit einer Gruppe von Menschen vom südasiatischen Kontinent im Berliner Zoo anwesend und warb damit, das authentische Leben Indiens in der Metropole zur Schau zu stellen. Dies rief enormen Protest indischer Menschen in Berlin hervor, der sich u.a. medienwirksam in Zeitungsberichten niederschlug.[27] Organisator:innen der Proteste waren u.a. der Verein der Inder in Zentraleuropa, aber auch Chatto selbst (vgl. Manjapra 2014).
Chattos politische Aktivitäten waren primär orientiert am antikolonialen Kampf gegen die britische Kolonialherrschaft in Indien und lassen sich über die europäischen Kolonialmetropolen London, Paris und Berlin hinweg nachzeichnen. Seine politische Praxis war zum Einen daran orientiert, aus den kolonialen Zentren heraus für die Sache der indischen Unabhängigkeit zu mobilisieren, und zum Anderen, koloniale Verhältnisse in der Metropole zu kritisieren, wie die Proteste von 1926 andeuten. Zugleich richtete er seinen politischen Aktivismus mehr und mehr in Richtung der Kommunistischen Internationale aus und erhoffte sich mit der Sowjetunion als Unterstützung, seinem vorrangigen Ziel der Befreiung Indiens von der Kolonialherrschaft näherzukommen (vgl. Manjapra 2014) . Ähnlich gingen auch Aktivist:innen anderer kolonialer Kontexte vor, wie im Weiteren zu erläutern sein wird.
Die Liga gegen Imperialismus: internationalistische Begegnungsräume in Berlin
Mit der Präsenz des Internationalen Sekretariats der Liga gegen Imperialismus ab 1927 in der Friedrichstraße 24 fand die Vernetzung antikolonialer Aktivist:innen in Berlin[28] – unabhängig von ihrer Herkunft – eine konkrete Form. Die Genese der – in heutigen Begriffen – ethnisch divers zusammengesetzten Bündnisorganisation lässt sich gut in den verschiedenen Vorgängerorganisationen und Zielsetzungen nachzeichnen: Aus vereinzelten Solidaritätsbekundungen in Berlin gegen die koloniale Unterdrückung in Syrien und Marokko Mitte der 1920er wie auch der Kampagne “Hände weg von China“ von 1926[29] organisierte sich die Liga gegen Kolonialgreuel und Unterdrückung, aus deren Wirkungskreis später die Liga gegen Imperialismus entstand (vgl. Dinkel 2015, Terkessidis 2022). Mitinitiator der Kampagnen sowie der Liga war der gebürtige Erfurter und kommunistische Aktivist Willi Münzenberg. Er zählte 1919 zu den ersten KPD-Mitgliedern und organisierte im Auftrag Moskaus etwa die Internationale Arbeiterhilfe 1921 mit Sitz in Berlin (vgl. Bayerlein & Sonnenberg 2013). Sein Engagement und seine Vernetzung mit antikolonialen Aktivist:innen unterschiedlicher Herkunftsregionen in Berlin ist zentral, um das Community-übergreifende Bündnis der Liga gegen Imperialismus einzuordnen.
Aus der Initiative der Liga gegen Kolonialgreuel und Unterdrückung und auf Geheiß der kommunistischen Zentrale[30] in Moskau erfolgte die Planung und Vorbereitung eines internationalen Kongresses, der ein breites Bündnis von Arbeiter:innen und kolonial Unterdrückten zusammenbringen sollte (vgl. Petersson 2013). Ursprünglich angedacht waren als Kongressorte Berlin oder Paris, jedoch hatten die Organisator:innen Probleme, entsprechend repräsentative Räumlichkeiten zu finden. Erst mit der Unterstützung des sozialistischen Außenministers Émile Vandervelde ließ sich in der Kolonialmetropole Brüssel der Palais d’Egmont als Kongressort gewinnen – im Gegenzug wurde das Thema der belgischen Kongopolitik von der Tagesordnung gestrichen (vgl. Dinkel 2015: 34).
Brüsseler Kongress
Im Februar 1927 fand der Kongress gegen koloniale Unterdrückung und Imperialismus in Brüssel statt. Laut dem offiziellen Protokoll nahmen 174 Delegierte und zahlreiche Gäste an der Konferenz teil (vgl. Liga gegen Imperialismus 1927: 227), die 137 Organisationen und Parteien aus 37 Ländern vertraten (vgl. Piazza 1987: 6). An anderen Stellen listet das Protokoll insgesamt 212 Namen (vgl. ebd.), einige von ihnen prominente Intellektuelle, z.B. Henri Barbusse, Upton Sinclair und Maxim Gorki. Albert Einstein war nicht anwesend, schickte aber einen unterstützenden Brief (vgl. Jones 1996: 7). Auf der Konferenz wurde die Liga gegen Imperialismus offiziell gegründet (vgl. ebd.: 6). China stand im Mittelpunkt der Konferenz und war am stärksten vertreten – etwa 60 bis 80 chinesische Vertreter:innen hatten sich angemeldet, unter ihnen sowohl Vertreter:innen der Kuomintang Partei als auch Generäle und Vertreter:innen der Gewerkschaften (vgl. Piazza 1987: 22). Die Vielfältigkeit seiner Teilnehmer:innen und der Beschluss von breiten Bündnissen zeichnete den Brüsseler Kongresses aus und machte ihn zu einem einzigartigen Ereignis: Es waren “Kommunisten, Sozialdemokraten, Anarchisten, Pazifisten, bürgerliche Intellektuelle oder Freiheitskämpfer” (ebd.: 26) vertreten, die alle durch ihr antiimperialistisches Bestreben geeint waren.[31]
Unter den Teilnehmer:innen befanden sich vier koreanische Delegierte, zwei weitere nahmen als Reporter teil (vgl. Hoffmann 2015: 76). Der Verein Koreanischer Schriftsteller und Journalisten, Seoul, war vertreten durch Li Kolu (Yi Kŭng-no) und Wovil Whang (Hwang U‑il), die beide zu dieser Zeit in Berlin lebten. Kin Fa Lin (Kim Pŏm-nin) vertrat den Verein der Koreaner in Frankreich. Yi King Li (Mirok Li) vertrat als einziger den Verein Koreanischer Studenten in Deutschland (Koryŏ Studentenvereinigung) (vgl. Liga gegen Imperialismus 1927: 234). Mirok Li war Schriftsteller und einer der prominentesten Koreaner:innen in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, der in Süddeutschland studierte und lebte und mit der Veröffentlichung des autobiographischen Romans Der Yalu fließt Bekanntheit erlangte. Er war kein Sozialist, doch er verfasste zusammen mit Yi Kŭng-no (Li Kolu), der überzeugter marxistisch-leninistischer Aktivist in Berlin war, die Resolution der koreanischen Delegation (Hoffmann 77). In der Resolution heißt es, dass “Korea seinen Anspruch auf völlige Unabhängigkeit vor der ganzen Welt begründet [hat]”. Falls Japan diese Unabhängigkeit nicht anerkenne, sehe man sich gezwungen “den Kampf gegen den japanischen Imperialismus bis aufs äußerste fortzusetzen” (vgl. Liga gegen Imperialismus 1927: 261).
Sen Katayama, Begründer der japanischen Arbeiterbewegung und Mitbegründer der Japanischen Kommunistischen Partei, hielt auf der Konferenz eine Rede mit dem Titel “Der Kampf des koreanischen Volkes gegen Japan”. Im Namen der koreanischen Delegation sprach der Vertreter des koreanischen Verbandes in Frankreich, Kim Pŏm-nin, aka Kin Fa Lin (vgl. Liga gegen Imperialismus 1927: 148), der auch als Mitglied des Generalrates gewählt worden war (vgl. ebd. 242). Seine leidenschaftliche Rede, welche die Auswirkungen des japanischen Imperialismus und Kolonialismus beschrieb, war extrem detailliert und lang – er nutzte die Tatsache aus, dass es keine fixierte Redezeit gab (vgl. Piazza 1987: 23).
Auch eine indische Delegation war auf dem Kongress vertreten:Jawahar Lal Nehru wurde vom Allindischen National-Kongress entsandt. Gemeinsam mit A.C.N. Nambiar[32] und Chatto
(beide Verband indischer Journalisten) sowie dessen Neffen Jayasurya Naidu (Verband der Inder in Zentraleuropa), waren alle vier in verschiedener Weise und Zeiten in Berlin im antikolonialen bzw. nationalistischen Kampf aktiv. Teil der indischen Delegation, jedoch im angelsächsischen Kontext verortet waren Bakar Ali Mirza (Indische Vereinigung Oxford), Sinha (Indisches Informationsbüro der I.L.P, London) und Professor M. Baraktulla (Indische Freiheitspartei Amerika, vgl. Das Flammenzeichen: 35).
Nehrus Rede vor dem Kongress unterstrich die Dringlichkeit der Befreiung Indiens von der britischen Kolonialherrschaft. Bemerkenswert an seiner Rede ist jedoch Indiens Solidarisierung mit den Kämpfen der Chines:innen gegen die britische Herrschaft, wie damalige Protokollant:innen des Kongresses notieren (vgl. ebd.: 13). Um dies einzuordnen, sollte auch in Betracht gezogen werden, dass die Lage Chinas Hauptthema des Kongresses war und die politische Situation zeithistorisch Dringlichkeit besaß.
Der fünftägige Kongress, den eine beeindruckende Presseberichterstattung begleitete, endete mit der offiziellen Gründung der Liga gegen Imperialismus und der Verabschiedung der Statuten (nachzulesen unter ebd.: 37ff.) sowie der Wahl des Generalrats. Nehru wurde bei der Wahl zum Exekutiv-Mitglied des Generalrats gewählt (neben u.a. Willi Münzenberg, Liau Hanson, Lamine Senghor, vgl. ebd. 27). Im Anschluss an den Kongress folgte die Gründung von regionalen Sektionen und der offiziellen Einberufung des Verbindungsbüro der Liga in der besagten Friedrichstraße 24.
Nach[33] dem Brüsseler Kongress: Verbindungen
Der Auftrieb, den der Brüsseler Kongress für die antikoloniale und ‑imperialistische Bewegung weltweit bedeutete (wie etwa der Konferenz von Bandung von 1955), aber auch die Grenzen seiner Wirkmacht, inneren Spaltungen bis zur stillschweigenden Auflösung 1937, sind in der Forschung hinlänglich diskutiert worden (vgl. u.a. Dinkel 2015: 44ff). Wir möchten uns nun nochmals auf den räumlichen Kontext Berlins fokussieren.
Den Aufwind des Brüsseler Kongresses schlug sich in Berlin auch durch die zunehmende Vernetzung von antikolonialen Aktivist:innen aus. Beispielhaft sei hier eine linke japanische Studierendengruppe genannt, die sich unter dem Namen Vereinigung der revolutionären Asiaten versammelte. Es ist davon auszugehen, dass sowohl koreanische als auch indische Aktivist:innen in Kontakt mit dieser Gruppierung standen (vgl. Hoffmann 2015: 79f. ). Die Gruppierung gab von März 1932 bis Januar 1933 die Zeitschrift Revolutionäres Asien: Das Organ der Vereinigung der revolutionären Asiaten heraus (vgl. Hoffmann 2015: 79f.). In der ersten Ausgabe hieß es:
“[…] Auf dem asiatischen Kontinent wächst die revolutionäre Welle, in China, in Indien, in Indochina, in Indonesien, ebenso in den Ländern des nahen Ostens. In dem imperialistischen Japan wie auch in den imperialistischen Ländern Europas und Amerikas kämpfen die revolutionären Arbeiter energisch gegen die kapitalistische Herrschaft. […] Die Schaffung der revolutionären Solidarität zwischen der kolonialen und halbkolonialen Bevölkerung Asiens, und der Solidarität zwischen ihnen und dem Proletariat der kapitalistischen Länder, ist ein mächtiger Schlag gegen den Imperialismus und seine Lakaien. Zu diesem Zweck ist die Vereinigung der revolutionären Asiaten in Berlin gegründet. Sie ist die Organisation der revolutionären Elemente aus allen Teilen Asiens. Die Vereinigung ist für den kompromisslosen Kampf gegen den Imperialismus und seine Lakaien. Das Hauptziel der Organisation ist die Schaffung der Solidarität zwischen den Asiaten in Deutschland, und die Befestigung der Verbundenheit und Sympathie zwischen der deutschen Bevölkerung und den Unterdrückten in Asien.” (Revolutionäres Asien 1923, Nr. 1.: 4f)
Die Zeitschrift und Vereinigung kann als Versuch verstanden werden, den imperialistischen pan-Asiatismus, den Japan in seiner Expansionspolitik betrieb, strategisch umzudrehen – als eine Vernetzung von verschiedenen unterdrückten Völkern in Asien (und darüber hinaus) gegen jeden Imperialismus. Dass in beiden Heften auch Beiträge zur Situation in Indien vorhanden sind, deutet darauf hin, dass die Aktivist:innen untereinander in Kontakt standen und japanische und koreanische Aktivist:innen es als politisch wichtig ansahen, den indischen Kampf mit dem ostasiatischen Kampf zu verknüpfen. So beinhalten die Zeitschriften auch stets einen Aufruf, für die Thematik relevante Beiträge einzuschicken.
Leider ließ sich im Rahmen unserer Recherchen nicht weiter rekonstruieren, wer konkret an der Erstellung der Zeitschrift beteiligt war und wie die Wege der Verbindungen mit anderen antikolonialen Aktivist:innen im Berlin der Weimarer Zeit zustande kamen. In der Ansprache können wir jedoch davon ausgehen, dass die Autor:innen davon ausgingen, von indischen und koreanischen Aktivist:innen im deutschsprachigen Raum gelesen zu werden.
Berlin als Ort der Begegnung
Anhand der in diesem Artikel betrachteten Fallbeispiele lassen sich neben den Präsenzen indischer und koreanischer Menschen im Berlin der 1920er und frühen 1930er auch die politische Organisierung mitsamt der Ambivalenzen verschiedener Akteur:innen im antikolonialen Kampf nachvollziehen. Ihre Selbstpositionierungen und Fremdzuschreibungen waren kontextabhängig. Zudem lassen sie sich auf einem breiten politischen Spektrum verorten. Auch wenn die politische Zielsetzung – die Befreiung von kolonialer Unterdrückung – ihnen gemeinsam war, so gab es doch divergente nationalistische, kommunistische, liberale, faschistische, sozialistische und konservative Ausrichtungen der jeweiligen Akteur:innen, die auf komplexe Art und Weise in das Weimarer und das nationalsozialistische Berlin verwickelt waren. Mit Blick auf den von uns lose verwendeten Community-Begriff wird daran deutlich, dass zwar von einem gemeinsamen Ziel, aber zu keinem Zeitpunkt von einer homogenen politischen Haltung innerhalb der jeweiligen Communities gesprochen werden kann.
Hilfreich ist der Community-Begriff gewesen, um die Vernetztheit der jeweiligen Akteur:innen in Berlin aufzuzeigen: Koreaner:innen teilten untereinander andere Räume als Inder:innen es in Berlin taten; zum Teil überschnitten sie sich. Die indische Präsenz im Weimarer Berlin war stark geprägt von bildungsaffinen Menschen, häufig aus einer gehobenen sozialen Schicht. Der Community-Begriff ermöglicht dabei eine Benennung dieser sozialen Gruppen im Berliner Raum, ohne den Blick ausschließlich auf ethnonationale Beschreibungen essentialisierend zu verengen.
Es wird deutlich, dass der Asien-Begriff, wie bereits eingangs erläutert, schon immer instabil gewesen ist. Dies zeigt sich sowohl in der Fremdbetrachtung der Akteur:innen durch deutsche Autoritäten, Medien und Gesellschaft als auch in der Nutzung des Asien-Begriffs durch die betrachteten Akteur:innen selbst. Am Beispiel der Revolutionären Asiaten wird deutlich, dass Asien bzw. asiatisch durchaus als Selbstbezeichnung gewählt wurde, aber an ein strategisches Verständnis von Asien im antikolonialen Kampf gegen die Unterdrückung geknüpft war.
Insbesondere wenn wir uns räumlich vor Augen halten, wo es indische und koreanische Präsenzen im Berlin der Zwischenkriegszeit gab und an welchen Orten und welchen Institutionen sich Aktivist:innen eingebracht haben, wird deutlich, dass es Berührungspunkte und Begegnungsorte zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen mit Asien-Bezug gegeben haben muss. Einige dieser Orte und Kontexte haben wir versucht nachzuzeichnen – andere bleiben an diesem Punkt spekulativ. Doch ist es leicht sich vorzustellen, dass ähnliche Räume frequentiert wurden und es zu vielen Begegnungen kam – ob auf der Friedrichstraße, der Kantstraße oder an den Universitäten. Ein fruchtvoller Ansatz für weitere Recherchen wäre in unseren Augen eine systematische Verräumlichung. Durch Arbeit mit z.B. Zeitungsartikeln, Protokollen, Briefen, Flugblättern, Adressbüchern, Stadtkarten und anderen relevanten Materialien aus Archiven würden sich konkretere Rückschlüsse auf Begegnungsorte ziehen lassen.
Unser Artikel bietet einen Einstieg in ein solches Projekt und lädt dazu ein, weitere ansonsten historiografisch getrennt beforschte Communities in Verbindung zu betrachten und damit auch den historischen Raum von Berlin unter der Perspektive seiner Community-übergreifenden Begegnungen in den Blick zu nehmen.
AUTOR*INNEN
Anujah Fernando ist Kulturwissenschaftlerin. In Ausstellungen, Filmprojekten und Texten arbeitet sie zum Themenbereich Gegenerzählungen von Migration und Kolonialismus. Sie interessiert sich besonders für die sprachlichen und kulturellen Aushandlungsprozesse zwischen der ersten und zweiten Generation von Migrant:innen.
https://anujahfernando.net
Linh Müller hat Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin, am Middlebury College und an der Yale University studiert. Sie interessiert sich sowohl für die affektive Reproduktion und Repräsentation von race und nationaler Zugehörigkeit in Popkultur als auch für das materielle und immaterielle Erbe von Kolonialismus. Sie grübelt außerdem über ihre verschiedenen Identitäten und Positionierungen und verhandelt diese, oft im Zusammenhang mit ihrer Familiengeschichte, in Texten und Audioformaten.
LITERATURVERZEICHNIS
PRIMÄRLITERATUR
2. Olympia-Sonderheft (1936): Berliner Illustrierte Zeitung, Berlin: Ullstein A. G. Berlin.
Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld (1936): Die Olympischen Spiele 1936, Bd. 2, Hamburg: Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld.
Protokoll des Kongresses gegen Koloniale Unterdrückung und Imperialismus, Brüssel 10–15. Februar 1927, Berlin: Neuer Deutscher Verlag.
Revolutionäre Asiaten (1932): Revolutionäres Asien: Das Organ der Vereinigung der revolutionären Asiaten, Nr. 1 und 2, Berlin: MOPR-Verlag Berlin.
Riefenstahl, Leni (1938): Olympia – Fest der Völker, Teil 1 und 2.
Stöcker, Helene (1927): Der Brüsseler Kongreß gegen koloniale Unterdrückung und Imperialismus, in Die Friedenswarte, Bd. 27, Nr. 3, S. 81–82. [Auch online] https://pm20.zbw.eu/mirador/?manifestId=https://pm20.zbw.eu/iiif/folder/co/065567/manifest.json [abgerufen am 2.12.2022].
Stöcker, Helene (1929): Der II. Anti-Imperialistische Kongreß in Frankfurt a. M, in Die Friedenswarte, Bd. 29, Nr. 9, S. 270–274.
Zeitungsbericht, Autor:in unbekannt (1926): “Der Zoo, ein neuer Lunapark. Der Schwindel in der Indienschau”, In: Die Welt am Abend, 3. Juli 1926
SEKUNDÄRLITERATUR
Barooah, Nirode (2004): Chatto. The life and Times of an Indian Anti-Imperialist in Europe, Oxford: University Press.
Bayerlein, Bernhard & Sonnenberg, Uwe (2013): Willi Münzenberg formt die Internationale Arbeiterhilfe (IAH), [online] https://www.muenzenbergforum.de/muenzenberg-formt-die-internationale-arbeiterhilfe/ [abgerufen am 2.12.2022].
Bi, Yingrui (2021): Die Hong-Kong Bar im Hamburger Stadtteil St. Pauli, Re-Mapping Memories, [online] https://www.re-mapping.eu/de/erinnerungsorte/hong-kong-bar [abgerufen am 30.11.2022].
Cho,Joanne Miyang / Lee M. Roberts (2018): Transnational Encounters between Germany and Korea: Affinity in Culture and Politics Since the 1880s, New York: Palgrave Macmillan.
Dinkel, Jürgen (2015): Die Bewegung Bündnisfreier Staaten: Genese, Organisation und Politik (1927–1992). Studien zur internationalen Geschichte, Band 37. Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
Guttmann, Allen (2006): Berlin 1936: The Most Controversial Olympics, in Alan Tomlinson / Christopher Young (Hrsg.), National Identity and Global Sports Events: Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World Cup, Albany: SUNY Press.
Hoffmann, Frank (2015): Berlin Koreans and Pictured Koreans, Wien: Praesens.
Jones, Jean (1996): The League Against Imperialism, in Socialist History Society Occasional Pamphlet Series, Bd. 4.
Kitei Son (o.D.): Olympic Games, [online] https://olympics.com/en/athletes/kitei-son [abgerufen am 29.11.2022].
Krebs, Gerhard (2015): Racism under Negotiation: The Japanese Race in the Nazi-German Perspective”, in Rotem Kowner / Walter Demel (Hrsg.), Race and Racism in Modern East Asia, Vol. II: Interactions, Nationalism, Gender and Lineage, Leiden: Brill.
Krüger, Arnd / William Murray (2003): The Nazi Olympics: Sport, Politics, and Appeasement in the 1930s, Champaign: University of Illinois Press.
Kuck, Nathanael (2014): Anti-colonialism in a Post-Imperial Environment – The Case of Berlin, 1914–33, in Journal of Contemporary History, Bd. 49, Nr. 1, Special Issue: Migration in Germany’s Age of Globalization, S. 134–159.
Law, Ricky W. (2009): Runner-up: Japan in the German Mass Media during the 1936 Olympic Games, in: Southeast Review of Asian Studies, Bd. 31, S. 164–80.
Law, Ricky W. (2019): Transnational Nazism: Ideology and Culture in German-Japanese Relations, 1919–1936, Cambridge: Cambridge University Press.
Liebau, Heike (2015): Erster Weltkrieg – Das Deutsche Kaiserreich und der Dschihad. Interview Deutschlandfunk.[online] https://www.deutschlandfunkkultur.de/erster-weltkrieg-das-deutsche-kaiserreich-und-der-dschihad-100.html [abgerufen am 28.11.2022].
Liebau, Heike (2017): Chattopadhyaya, Virendranath. In: International Encyclopedia of the First World War. [online].: https://encyclopedia.1914–1918-online.net/article/chattopadhyaya_virendranath [abgerufen 9. 11. 2022].
Petersson, Frederik (2013): “We Are Neither Visionaries nor Utopian Dreamers”. Willi Münzenberg, the League against Imperialism, and the Comintern, 1925–1933. [online] https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90023/petersson_fredrik.pdf [abgerufen am 2.12.2022]
Oesterheld, Joachim (2004): Aus Indien an die Alma mater berolinensis – Studenten aus Indien in Berlin vor 1945, In: Periplus 2004, Jahrbuch für Außereuropäische Geschichte (14. Jahrgang), Münster
Piazza, Hans (1987): Die Antiimperialistische Liga – die erste antikoloniale Weltorganisation, in: Die Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit 1927–1937, Zur Geschichte und Aktualität einer wenig bekannten antikolonialen Weltorganisation, Protokoll einer wissenschaftlichen Konferenz am 9. und 10. Februar 1987 an der Karl-Marx-Universität Leipzig.
Podoler, Guy (2021): From the Berlin Olympics marathon to a park in Seoul: Sohn Kee-Chung and the construction of sports heritage in South Korea, in: Sport in Society.
Raychandhuri, Tapan (2004): Naidu [née Chattopadhaya] Sarojini. Aus: Oxford Dictionary of National Biography. [online] https://doi.org/10.1093/ref:odnb/47743 [abgerufen am 14.11.2022]
Spannagel, Lars (2016): Olympische Geschichte in Berlin: Rückkehr unter wahrer Flagge, in: Tagesspiegel, 13.12.2016, [online] https://www.tagesspiegel.de/sport/ruckkehr-unter-wahrer-flagge-3780817.html [abgerufen am 29.11.2022].
Terkessidis, Mark (2022): 1929 – Die Liga gegen den Imperialismus bekommt ein neues Büro in der Friedrichstraße. In: Die postkoloniale Stadt lesen. Historische Erkundungen in Friedrichshain-Kreuzberg. Hrsg von Natalie Bayer und Mark Terkessidis. Berlin: Verbrecher Verlag.
von Piechowski, Nadine (2019): “St. Pauli war Hamburgs Chinatown“: Die Geschichte der Hong-Kong Bar, in FINK.HAMBURG, 28.01.2019, [online] https://fink.hamburg/2019/01/chinesenaktion-hamburg-marietta-solty/ [abgerufen am 30.11.2022].
Yu-Dembski, Dagmar (2007): Chinesen in Berlin, Berlin: berlin edition.
(HISTORISCHE) FOTOS (hier keine Abbildungen)
Straßenbeschilderung in Wünsdorf, die an “Halbmondlager” erinnert:
Fotografie der Moschee auf dem Wünsdorfer Kriegsgefangenenlager, vermutlich 1915:
- Otto Stiehl, Museum der Europäischen Kulturen https://www.spiegel.de/geschichte/halbmondlager-die-erste-deutsche-moschee-in-wuensdorf-a-1043358.html#fotostrecke-75280b9d-0001–0002-0000–000000128071
Zehrensdorfer Friedhof
Porträt von Chatto.
- Abb. gesehen in Terkessidis, Mark (2022): 1929 – Die Liga gegen den Imperialismus bekommt ein neues Büro in der Friedrichstraße, In: Die postkoloniale Stadt lesen. historische Erkundungen in Friedrichshain-Kreuzberg, Hrsg. von Natalie Bayer und dems., Berlin: Verbrecher Verlag, 2022. S. 264, vermutlich aus: Sehanbish, Chinmohan (1973): Rush Biplab O Prabasi Baratiya Biplabi, Kolkate: Manisha Granthalaya, S. 95.
Bildschirmaufnahme von An Pong-gŭn als indischer Tierwärter “Shing” in dem Film Männer müssen so sein
- Abb. gesehen in Hoffmann 2015: 32, Fig. (8)
Foto Son Ki-jŏng Statue in Berlin
- Statue in der Glockenturmstraße – entweder selbst aufnehmen oder aus dem Tagesspiegel Artikel von Spannagel (c LSB/Engler)
Foto Siegerehrung nach Son Ki-jŏngs Olympiasieg
- Associated Press: https://static01.nyt.com/images/2009/11/15/sports/15korea_CA1/articleLarge.jpg?quality=75&auto=webp
Scan einer Seite im Zigarettenbilderalbum (dort ist auch ein Foto von Sons Lauf zu sehen)
- Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld, Olympia 1936 Band II, „Der klassische Lauf“, S. 55
Foto von Kim Paek‑p’yŏng mit einem Kollegen am KWIA beim Vermessen
- gesehen in Hoffmann 2015: 139, Fig. 63, c Archive der Max-Planck-Gesellschaft Berlin, Bild #II/8
Scan Flyer vom Koryŏ Student Corps
- Abb. gesehen in Hoffmann 2015:63, Fig. 18, Kukka Pohunch’ŏ, comp., Haeoeŭi han’guk tongnip undong saryo, Vol. 1, Seoul: Kukka Pohunch’ŏ, 199, page 150.
Foto Generalrat Brüsseler Kongreß
- Der vom Kongreß gewählte Generalrat in Liga gegen Imperialismus, Das Flammenzeichen vom Palais Egmont, 1927: 251.
Cover von Zeitschrift “Revolutionäres Asien”
[1] Der Begriff Indien bzw. indisch wird in diesem Beitrag kursiviert gesetzt, um auf die ambivalente Hervorbringung dieses nationalen Konstrukts hinzuweisen. Teils durch die Wissensproduktion europäischer Wissenschaften und Kunst, teils im Rahmen der antikolonialen und nationalistischen Unternehmungen der indischen Unabhängigkeitsbewegung hervorgebracht, vermittelt der Begriff eine Homogenität, dessen gesellschaftliches Konstrukt wir anlässlich dieses Beitrags im Besonderen hervorheben möchten.
[2] Für einen detaillierten Überblick in die Debatten zum Begriff “Asien” sowie “Asiatisch-Deutsch”, sei im Besonderen auf den zuerst 2012 erschienenen Sammelband Asiatische Deutsche. Vietnamese Diaspora and Beyond, herausgegeben von Kien Nghi Ha, verwiesen. Eine erweiterte Neuauflage mit aktualisierten Beiträgen erschien 2021.
[3] Ein nennenswertes Beispiel aus dem industriellen Sektor ist die Tätigkeit des Berliner Betriebs Siemens zur Etablierung der kolonialen Infrastruktur zwischen Britisch-Indien und dem britischen Zentrum: Siemens begann 1866 mit dem Bau einer 11.000 km langen Verbindung von London nach Calcutta. Auf vorhandene Verbindungen von England nach Deutschland wurde zurückgegriffen und der Bau wurde nur bis zur indischen Grenze durch Siemens durchgeführt, da die Engländer innerhalb der indischen Begrenzungen bauen wollten. Die Telegraphen-Verbindung ging über Land- und Unterwasserseekabel durch das Schwarze Meer, 1870 wurde die Telegramm-Verbindung in Betrieb genommen. (vgl. Günther & Rehmer 1999: 22). Zu der Zeit hatte das Vorhaben eine Strahlkraft, die die Reputation deutscher Wissenschaft und Industrie in Indien hervorhob.
[4] Erwähnenswert ist hier die Tätigkeit des deutschen Ethnologen Adolf Bastian, der erstmalig 1859 nach Indien reiste, ab 1868 mit der Verwaltung der ethnographischen Abteilung der Berliner Museen betraut wurde und in dieser Funktion 1879⁄80 nochmals nach Indien reiste. Seine Sammlungstätigkeiten gingen in das Berliner Museum für Völkerkunde ein, aus dem 1963 die “Indische Kunstabteilung” in der Stiftung Preußische Kulturbesitz herausgelöst wurde.
[5] ab Oktober 1887, assoziiert an die Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin (spätere Humboldt Universität) mit oben genannten Sprachen sowie Swahili. Neben Sprachwissen, wurde hier Kenntnisse der Geografie, Ökonomie und des Rechts vermittelt. In der Lehre vermittelten Dozenten theoretisches Wissen und die Wissenschaften, Lektoren und Sprachgehilfen die sprachlichen Kenntnisse. Letzteres wurde häufig durch Lehrende aus den jeweiligen geografischen Kontexten bewerkstelligt.
[6] In zeitgenössischen Berichterstattungen wurde häufig von “Deutschlands erster Moschee” gesprochen. Dies wurde durch eine umfangreiche Bewerbung dieser Moschee in Form von Postkarten begleitet, die durch entsprechende Regierungsstellen veranlasst und in Umlauf gebracht worden sind und das Bild von “Deutschlands erster Moschee” unterstrichen. Dies muss rückblickend auch im Kontext der sog. “Dschihad-Strategie” bewertet werden. Daher sollte der Verweis auf “Deutschlands erster Moschee” mit Vorsicht vorgenommen werden. Tatsächlich stand die aus Holz erbaute Moschee in Wünsdorf etwa 10 Jahre, bevor sie 1925 abgerissen wurde. Sie war vermutlich nicht auf Dauer angelegt (vgl. Liebau 2015, DLF Interview).
[7] Einen Versuch unternimmt der Filmemacher Philipp Scheffner in dem Dokumentarfilm “Halfmoon Files”, in dem er ausgehend von einer Audio-Aufnahme des indischen Kriegsgefangenen Mall Singh, die heute im sog. Lautarchiv der Humboldt-Universität lagert, die Spuren seines Lebens zu rekonstruieren versuchte.
[8] Auch Indian Independence Committee (IIC) oder Berlin Komitee genannt.
[9] Mit dem Begriff “Koreaner:innen” sind in diesem Artikel sowohl Menschen aus dem heutigen Südkorea als auch Nordkorea eingeschlossen. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es nur ein Korea – die Teilung wurde als Konsequenz des Zweiten Weltkrieges vollzogen, als Japan die Kolonie Korea abtreten musste und eine sowjetische sowie eine amerikanische Besatzungszone begründet wurden. Die Grenze verlief am 38. Breitengrad und war ursprünglich nur als temporär angedacht. Die heutige Teilung Koreas kann somit sowohl auf Japans Imperialismus als auch auf den Kalten Krieg zurückgeführt werden. Zudem lässt sich zu der Begriffswahl “Koreaner:innen” hinzufügen, dass in keiner hier behandelten Quelle koreanische Frauen in Deutschland erwähnt werden. Diese gravierende Lücke sollte als Anlass genommen werden, weitere Nachforschungen anzustellen, ob sich tatsächlich koreanische Frauen in Deutschland befanden. Um automatische Ausschlüsse zu vermeiden, ist in diesem Text an mehreren Stellen von “Koreaner:innen” die Rede.
[10] Die Schreibweise koreanischer Namen orientiert sich in diesem Artikel an der McCune-Reischauer Romanisierung.
[11] Siehe zu Hintergründen der imperialistischen Expansion Japans und Kolonialisierung Koreas auch Peter Duus, The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895–1910 sowie Alexis Dudden, Japanese Colonization of Korea: Discourse and Power, 2006.
[12] Um den ehemaligen Schlesischen Bahnhof (heute Ostbahnhof) lebten vor allen Dingen chinesische Arbeiter:innen, Händler:innen und Hausierer:innen„ während in der Kantstraße und in Charlottenburg wohlhabende Studierende und Intellektuelle lebten (vgl. Yu-Dembski 2007: 20ff).
[13] Die Österreicherin Hertha Feiler, die später Heinz Rühmanns zweite Frau wurde, war die weibliche Hauptdarstellerin. Bemerkenswert ist hier, wie beliebig die ethnisierte Rollenzuschreibung von koreanischem Schauspieler und indischer Figur ist.
[14] Eine andere Schreibweise seines Namens ist Sohn Kee-Chung. In diesem Artikel wird die McCune-Reischauer-Romanisierung für alle koreanischen Namen verwendet.
[15] Die Bronzestatue bildet Son in einem Trikot ab, auf dem die koreanische Flagge zu sehen ist. In der Realität war auf seinem Trikot jedoch die japanische Flagge abgebildet.
[16] James Cleveland “J.C.” Owens wird als Sohn eines Sharecroppers im Süden der USA geboren. Sein Großvater war noch versklavt gewesen. Die Familie zog auf der Suche nach besseren Chancen nach Ohio. Aufgrund seines Südstaaten-Akzents verstand seine Lehrerin seinen Namen falsch – so wurde “J.C.” zu “Jesse” (vgl. Owens / Neimark 1970: 19). Die Bedeutung von Owens’ Präsenz und Medaillen in den Olympischen Spielen 1936 sowie seine nachfolgende Behandlung in den USA verdienen sehr viel mehr Aufmerksamkeit als ihnen hier gegeben werden kann.
[17] 600 Rom:nja und Sinti:zze wurden jedoch in der gleichen Zeit aus Berlin in ein Lager am Stadtrand deportiert und dort interniert, um sie vor den Tourist:innen der Olympischen Spiele zu verbergen. Dieses Camp bestand bis 1943, als die betroffenen Rom:nja und Sinti:zze nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurden (vgl. Krüger 2003: 25).
[18] In gewissem Maße findet man ähnliche Körperbeschreibungen rassifizierter Menschen auch heute noch in der Sportberichterstattung. Es gibt eine klare Kontinuität von rassistischen Stereotypen im Sport.
[19] 1942 wurden 300 Chines:innen in Berlin verhaftet und aufgrund der Vermutung von politischer Aktivität interniert (vgl. Hoffmann 2015: 35). In Hamburg wurden 1944 im Zuge der sogenannten “Chinesenaktion” Chines:innen festgenommen, misshandelt, gefoltert und zum Teil in KZs interniert. Einige starben an den Folgen der Misshandlungen. Überlebende wurden nie entschädigt (vgl. von Piechowski 2019, Bi 2021). 1945 wird das chinesisch-deutsche Ehepaar Tung aus ihrem Haus gejagt, der deutschen Frau wird der Kopf rasiert und sie wird auf der offenen Straße bloßgestellt (vgl. Hoffmann 2015: 35). Bis zum Kriegsende blieben jedoch etwa 400 Chinesen in Deutschland, die Staatsangehörige der pro-japanischen Nanking-Regierung waren (vgl. Yu-Dembski 2007: 73).
[20] Zu diesem Zeitpunkt war die koreanische Elite und damit die verbleibenden Studierenden in Deutschland vollständig in das Japanische Kaiserreich integriert und verschrieb sich den japanischen Interessen (vgl. Hoffmann 2015: 106).
[21] Leni Riefenstahl bestritt bis zuletzt, dass ihr Werk über die Olympischen Spiele Propaganda für die Nationalsozialisten gewesen sei (vgl. Guttmann 2006: 65). Unbestreitbar ist die Tatsache, dass sie eine freundschaftliche Beziehung mit Adolf Hitler verband und sie die Regie führte für den NS-Propagandafilm Triumph des Willens (vgl. ebd.: 74).
[22] Übersetzung durch die Autorin; Koryŏ Student Corps auf Englisch und Yudŏk Koryŏ Haguhoe auf Koreanisch
[23] Es ist zu vermuten, dass es sich hierbei um den “Hauptverband der Chinesischen Studenten in Deutschland” handelt. Dieser Verein hieß ehemals “Verein der Chinesischen Studenten” und hatte etwa 280 hauptsächlich bürgerliche Mitglieder, bis er von “revolutionären Studenten” umbenannt wurde. Die Büros lagen in der Kantstr. 122 (vgl. Yu-Dembski 2007: 45f.).
[24] Auch als Hindusthan Association of Central Europe geführt, Büro in der Fasanenstraße 23. (Vgl. Neue Horizonte 1928: 9)
[25] vertiefend zur Familiengeschichte, siehe Tapan Raychanduri 2004.
[26] von 1929 bis 1930 als “Indisches Informationsbüro”
[27] Beispielhaft sei hier der Zeitungsbericht mit dem Titel “Der Zoo, ein neuer Lunapark. Der Schwindel in der Indienschau” einer anonymen Autor:in in der Welt am Abend vom 3. Juli 1926 erwähnt.
[28] Das Büro befand sich ab 1927 in der Friedrichstraße 24 , danach bis 1933 Hedemannstraße 13 (beides heute Kreuzberg).
[29] Das sog. Shanghai-Massaker vom 30.5.1925 war Anlass von Protesten in Berlin, u.a. am 8.7.1925 in der Siemens-Oberschule in Charlottenburg, und auch Anlass zum Kongress “Hände weg von China” am 25.8.1925 in Berlin.
[30] Mit Blick auf die Fragestellung verzichten wir in diesem Artikel auf eine ausführliche Darstellung der Verflechtung von antikolonialen Kämpfen und den Zielen der Kommunistischen Internationale und verweisen auf weiterführende Literatur, wie etwa Hakim Ali 2008, Harald Fischer-Tiné 2008.
[31] Nach dem Brüsseler Kongress zerfiel dieses breite Bündnis, unter anderem, weil die Partnerschaft zwischen der Kuomintang Partei und den Kommunist:innen in China von Chiang Kai-shek, Führer der Kuomintang, beendet wurde. Beim Zweiten Kongress waren Sozialdemokraten und nationalbürgerliche Organisationen nicht mehr vertreten (vgl. Piazza 1987: 33f.) und der Einfluss Moskaus sowie der Komintern war stark gestiegen (vgl. Jones 1996: 13). In den Folgejahren traten diverse national-reformistische Organisationen aus der Liga aus (vgl. Piazza 1987: 34).
[32] A.C.N. Nambiar war im Nazi-Deutschland zusammen mit Subhas Chandra Bose weiterhin im indischen Befreiungskampf aktiv. Nambiar leitete bspw. den Propagandasender Azad Hind Radio, das mit finanzieller Unterstützung Deutschlands zunächst von Deutschland aus gegen die Britische Kolonialherrschaft Nachrichten sendete. Weiterführend zu Boses and Nambiars Tätigkeiten in Deutschland, siehe Günther 2005.
[33] Bei dem nachfolgenden “II. Anti-Imperialistischen Kongreß in Frankfurt a.M.”, nun explizit kommunistisch ausgerichtet, waren laut Frauen- und Friedensaktivistin Helene Stöcker, die einen Bericht über die Konferenz in der Friedens-Warte veröffentlichte, wieder sowohl Inder:innen als auch Koreaner:innen vertreten. Inder:innen seien durch zwei Hauptgruppen vertreten gewesen: “einmal die mehr bürgerlichen, Gandhi nahestehenden, durch Gupta repräsentierten Kreise — von denen ihre Gegner allerdings behaupten, daß kaum 2 Prozent der indischen Bevölkerung hinter dem “allindischen Nationalkongreß” ständen, — die aber heute noch freundschaftlich mit der Liga und Sowjetrußland zusammengehen, und zweitens die Kommunisten” (vgl. 271f.). Was sich hier abzeichnet ist die innere Spaltung der Liga gegen Imperialismus nach den gewaltsamen Ausschreitungen der vermeintlich linken Kuomintang Bewegung gegen verbündete chinesische Kommunist:innen 1927, kurz nach dem Brüsseler Kongress (vgl. Dinkel 2015: 46).
Das Projekt wurde 2022 von der Berliner Landeszentrale für Politische Bildung gefördert.