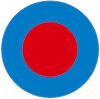von Puo-An Wu Fu
Als ich im Sommer 2018 eingeladen wurde, im Rahmen der Jahresabschlussveranstaltung von korientation e.V. einen Vortrag über mein Promotionsprojekt zum Thema transpazifische Literatur zu halten, war mein aller erster Gedanke, dass ich wohl die seltene Gelegenheit ergreifen sollte, meine eigenen Lebenserfahrungen miteinzubeziehen, anstatt einen deskriptiven oder wissenschaftlichen Bericht zu liefern. Dadurch erhoffte ich, eine Diskussion mit meinem Publikum hier in Deutschland anzuregen, wo sich alle Beteiligten auf Augenhöhe darüber austauschen konnten, inwiefern sich unsere Erfahrungen überschneiden und unterschieden, sowie ob ein Dialog zwischen der postmigrantischen Generationen in verschiedenen Kontinenten denkbar ist. Diesen Aspekt meines Forschungsvorhabens hatte ich bisher nur privat im engsten Freundeskreis besprochen.
Wie sicherlich für viele LeserInnen ist für mich die Frage „Wo kommst du wirklich her?“ eine problematische Alltagserfahrung. Genau diese Frage möchte ich zuerst beantworten und zwar nicht, weil mein Gegenüber eine vorbestimmte Antwort von mir verlangt, sondern weil ich es freiwillig erzählen möchte. Dass ich überhaupt darüber entscheiden darf, wem ich was über mich erzähle, scheint mir leider sehr selten vorzukommen, unabhängig davon, ob ich mich in Deutschland oder zu Hause in Chile befinde. Dieses Hinterfragen oder sogar die Verweigerung der Selbstbestimmung ist die Grundlage des vorliegenden Beitrags. Ausgehend von meiner eigenen Erfahrung werde ich im Folgenden versuchen, zwei zusätzliche Fragen zu beantworten: „Warum ein Forschungsprojekt über Schriftsteller und Schriftstellerinnen der zweiten Generation?“ und „Wozu brauchen wir unsere eigene Poetik, unsere eigene literarische Stimme?“
Dramatis Personae
Ich fange mit dem Ort des Schreibens an. Am 17. Oktober 2018 begann meine Heimreise nach Chile, die zweite nach der ersten Rückreise vor ungefähr zehn Jahren. Als ich geboren wurde, saß der Diktator Augusto Pinochet immer noch in dem Palacio de la Moneda, dem ikonischen Gebäude in Santiago de Chile, welches mit dem Kanzleramt hier in Berlin vergleichbar wäre. Aufgrund von meinem Geburtsort habe ich zwei Doppelnamen: zwei Vornamen, einen auf Chinesisch und einen weiteren auf Spanisch, der allerdings nicht in meinem Pass steht; und zwei Familiennamen, wie alle ChilenInnen einen väterlicher- und einen mütterlicherseits. Vollständig ist mein Name „Puo-An Francisca Wu Fu“. Manchmal darf ich entscheiden, wie ich heiße. Manchmal sind es andere Menschen, die diese Entscheidung für mich treffen.
Im Sommer 1999 gelang es meiner Mutter, den Traum von allen taiwanischen Einwanderern zu verwirklichen: Wir sind zusammen nach Kalifornien gezogen, wo mein Bruder und ich angeblich eine bessere Bildung und ein besseres Leben haben könnten. Neun Jahre später fiel mir ein, in Deutschland zu studieren. Kurz vor dem Umzug nach Deutschland konnte ich zum ersten Mal endlich wieder nach Hause. Diese erste Reise war eben vor ungefähr zehn Jahren.
Meine Heimatstadt Santiago befindet sich in einem Tal. Die sichtbare Luftverschmutzung und das ständige Husten erwecken Nostalgie in mir. Hier, zu Hause, hatte ich es vor, den Vortrag für korientation zu schreiben. Der Ort spielt nämlich eine ausschlaggebende Rolle für den Akt des Schreibens. Die Selbstdistanzierung, in diesem Fall von Europa aus über Amerika zu schreiben, kann eine vorteilhafte, ernüchternde Wirkung haben, wenn man sich vornimmt, sich möglichst sachlich einem Forschungsobjekt zu widmen. Aber für diesen Vortrag wollte ich eben nicht sachlich schreiben. Denn nur aus den Emotionen der Vergangenheit, die in meiner Heimatstadt hermetisch aufbewahrt waren, konnte ich wirklich fühlen, was auf dem Spiel steht, wenn man sich selbst zum wissenschaftlichen Forschungsobjekt macht. Nur an diesem Ort konnte ich den Sinn und die Notwendigkeit einer transpazifischen Poetik nicht nur intellektuell erfassen sondern vor allem affektiv fühlen.
Ein einziges Buch erlaubte ich mir nach Chile mitzunehmen, sodass ich nicht vor lauter Ablenkung kein einziges Wort aufschreibe: Much Ado About Nothing (MAAN) von William Shakespeare.
Erster Aufzug
Bastarde der Weltliteratur
Über William Shakespeare brauchen wir gewiss nicht viel zu sagen, da viele wenn nicht alle seiner literarischen Werken einen wesentlichen Bestandteil der sogenannten „Weltliteratur“ ausmachen. Sein Oeuvre wird in alle möglichen Sprachen immer wieder neu übersetzt und von zahlreichen Menschen an allen möglichen Orten der Welt bereits in den Schuljahren gelesen. Warum? Über Shakespeare hat ein anderer Dichter der „Weltliteratur“, der Chilene Pablo Neruda, in der Einführung zu seiner Übersetzung ins Spanische von Romeo and Juliet aus dem Jahre 1964 Folgendes geschrieben:
En cada época un bardo asume la totalidad de los sueños y de la sabiduría: expresa el crecimiento, la extensión del mundo. Se llama una vez Alighieri o Victor Hugo, Lope de Vega o Walt Whitman.
Sobre todo se llama Shakespeare.
(Neruda 1964, S.5)
[In jeder Epoche übernimmt ein Dichter die Gesamtheit der Träume und der Weisheit: Er bringt das Heranwachsen, die Reichweite der Welt zum Ausdruck. Manchmal heißt er Alighieri oder Victor Hugo, Lope de Vega oder Walt Whitman.
Vor allem heißt er Shakespeare.]
[Alle Zitate habe ich selbst ins Deutsche übersetzt]
Für Neruda scheint Shakespeare alles über die Welt zu wissen, was es zu wissen geben kann. Dabei ergibt sich die Frage, ob der Barde wirklich all unsere Träume und die gesamte Weisheit der Menschheit kannte, oder ob wir, historisch und kulturell distanzierte LeserInnen, aus Menschen der Vergangenheit literarische Giganten machen, um uns in den Welten der Anderen wiederzufinden, um dadurch eine universal verständliche Welt zu schaffen. Ist die Weltliteratur universal oder wird sie universal gemacht? Später kehren wir zu dieser Unterscheidung zurück.
Laut der ersten Auflage von Signet Classic wurde MAAN 1600 veröffentlicht. Zwar ist Shakespeare eher für seine Tragödien und Sonette weltbekannt, aber diese Komödie gehört auch zum Kanon der Weltliteratur. Im deutschsprachigen Raum gilt heutzutage die Übersetzung der deutschen Romantiker, die sogenannte Schiller-Tieck Übersetzung, als der Quelltext für alle deutschsprachigen Übersetzungen von Viel Lärm um nichts. Diese Übersetzung wurde 1830 veröffentlicht, zu der gleichen Zeit, als sich Goethes Gedankengut über die Übersetzbarkeit von Literatur, das wir heutzutage in der Form der Gattung namens „Weltliteratur“ kennen, herauskristallisierte.
Ich hatte dieses Buch nicht ohne Grund in den Koffer getan. In MAAN geht es hauptsächlich um zwei Liebesgeschichten, aber uns interessiert eher die Beziehung zweier Hauptfiguren. In der ersten Szene erfahren wir, dass Don Pedro, auch Don Peter und Prince of Arragon (auch Aragon) genannt, im Laufe der kommenden Tage in Messina ankommen soll. Ihn begleitet der Bösewicht der Komödie, sein Bruder Don Juan, auch Don John, John the Bastard und the Bastard im englischen Text genannt.
Don John interessiert uns aus einem konkreten Grund, und es hat mit seiner Ethik zu tun. Kurz vor der Anreise in Messina hatte sich Don John mit seinem Bruder versöhnt, weshalb Leonato, der Gouverneur der Stadt Messina, ihn überhaupt empfangen darf und muss. Daraufhin begrüßt ihn Leonato in der ersten Szene mit folgenden Worten:
Let me bid you welcome, my lord; being reconciled to the Prince your brother, I owe you all duty.
(MAAN Z. 149–151)
[Ich heiße Sie willkommen, mein Herr; nach Ihrer Versöhnung mit dem Prinzen, Ihrem Bruder, bin ich Ihnen zu Diensten verpflichtet.]
In Shakespeares Komödie existiert Don Jon nur im Verhältnis zu seinem Bruder. Er wird zusammen mit dem Legitimen empfangen, ist aber selbst nicht legitim. Don John ist darüber hinaus ein Adeliger —„my lord“— aber zugleich nicht ganz ein Prinz wie sein Bruder. Was vor der Versöhnung geschehen ist, erfahren wir als LeserInnen nicht. Eines lässt sich aber feststellen: Don John muss seine Beziehung zu seinem legitimen Bruder pflegen, ihm nah sein, sozusagen, um gesellschaftlich akzeptiert und sichtbar werden zu können. Peter ist aus einer sittlich legitimen Ehe geboren worden, müssen wir annehmen; er ist der wahre Prinz von Arragon. John hingegen müsste aus einer illegitimen Vermählung geboren worden sein; die Elternteile stammten vermutlich aus gesellschaftlich inkompatiblen Schichten. In diesem Sinne hat John kein Recht auf Selbstbestimmung. Seine gesellschaftliche Akzeptanz wird von seiner Beziehung zu seinem Bruder bestimmt. Wäre er nicht mit Peter versöhnt, wäre es nicht sittlich gewesen, ihn anzuerkennen und in Messina zu empfangen.
Diese Handlungsunfähigkeit gegenüber der Selbstbestimmung, die gleichzeitig aufgrund von und ausgehend von seiner Geburt entstanden ist, führt dazu, dass Don John sich zu allem bereit erklärt, was Don Peter das Leben erschweren könnte. Seinerseits war es nämlich eine rein aus Notwendigkeit vorgegaukelte Versöhnung mit Peter. Sich gegen seinen Bruder zu stellen, allerdings ohne entdeckt zu werden und dadurch seine Quasi-Legitimation zu verlieren, ist die einzige Handlungsmöglichkeit, die er für sich sieht. Im ersten Aufzug 3. Szene sagt John Folgendes über seinen Bruder:
I had rather be a canker in a hedge than a rose in his grace […]. In this, though I cannot be said to be a flattering honest man, it must not be denied but I am a plain-dealing villain. I am trusted with a muzzle and enfranchised with a clog; therefore I have decreed not to sing in my cage. If I had my mouth, I would bite;
if I had my liberty I would do my liking.
(MAAN Z. 24–34)
Aus einem unbekannten Grund kann Don John seinen Bruder gar nicht leiden, aber er weiß ganz genau, dass er den Prinzen braucht. Daher die Metapher „trusted with a muzzle“: Wie ein mit einem Beißkorb gezähmtes Tier. Das Wort „enfranchised“ ist hier auch entscheidend. Ins Deutsche übersetzt könnte es soviel wie „befreit“ bedeuten, aber ich finde es nicht uninteressant, dass wir dieses Wort heutzutage eher mit Wahlberechtigung assoziieren.
Wir sehen hier, dass John widersprüchliche ethische Prinzipien einhalten muss. Zum einen muss er mit seinem Bruder auf gutem Fuß stehen, damit er Teil der Gesellschaft sein kann. Zum anderen aber will er, der Bösewicht, seine wahre Natur nicht verweigern: Er sagt „it must not be denied but I am a plain-dealing villain“. Aufgrund von dieser Zwiespältigkeit fühlt er sich wie in einem Käfig gefangen: „Enfranchised with a clog“, durch ein Hemmnis befreit. Dieser Zwiespalt ist sein Raison d’Être. Er will nichts Anderes als sich gegen seinen Bruder zu stellen, aber gleichzeitig braucht er ihn und seine Legitimität, um seine Freiheit zu behalten. Und selbst da, wenn er durch seinen Bruder legitimiert wird, bleibt er immer noch der Bastard. Für immer sein Halbbruder, der Bastard, und nie einfach nur John.
Nun, was hat dieser Bastard der Weltliteratur mit unserem Thema zu tun? Die Frage der Legitimität, der Akzeptanz und Selbstbestimmung scheint mir ein guter Ausgangspunkt zu sein, bei dem wir anfangen können, über die Literatur der postmigrantischen Generation zu sprechen. Die Frage „Wo kommst du wirklich her?“ ist nichts anderes als eine Infragestellung unserer Legitimität. Erst wenn ich durch meine Eltern legitimiert werde („Eigentlich kommen meine Eltern aus Taiwan“), darf ich empfangen werden. Ohne zuerst mein Verhältnis zu ihnen erklärt zu haben, scheint mein Dasein ein peinliches Paradox zu sein. Wenn ich mich weigere, mit diesem Satz das Paradox zu lösen, nehmen sich manche Menschen vor, es für mich zu tun: Auf „Ich bin Chilenin“ folgt „Ach so, du bist hier geboren!“. Wären meine Vorfahren statt aus Taiwan aus einer der ehemaligen europäischen Kolonialmächten nach Chile eingewandert, hätte ich braune Haare und grüne Augen zum Beispiel, wäre es nicht notwendig gewesen, meine leider irrtümliche Aussage über mich selbst zu berichtigen. Für Bastarde gibt es keine Selbstbestimmung, nur Befreiung durch ein Hemmnis.
Wie der lateinamerikanische Fall zeigt, werden nicht alle postmigrantischen Menschen für Bastarde gehalten. Aber statt über die herrschenden Machtasymmetrien zu denken, würde ich lieber zurück zur Literatur kommen. In „Invasionen des Privaten“ schreibt die österreichische Schriftstellerin Anna Kim:
Anerkennung, der zwangsläufig Akzeptanz vorangehen muss, ist etwas, das uns leicht verwehrt werden kann (und immer wieder wird). Identität in unseren Augen ist weniger eine Schnittstelle zwischen Subjekt und Gesellschaft als vielmehr eine
Bedrohung —
(Kim 2011, S.38)
Alle Bastarde erleben diese Bedrohung. Anders als in Deutschland konnte ich in Chile die emotionale Wirkung der Frage weder ignorieren noch akzeptieren. In Deutschland kam es auf einen pragmatischen Umgang mit meinen Mitmenschen. Zu Hause aber ging es um Zugehörigkeit. Dort schien mir jede Begegnung, sich um die zerbrechliche Anerkennung zu drehen. Vom Fahrkarten am Kiosk kaufen bis die Nachbarin im Aufzug begrüßen, erlebte ich die Bedrohung, tagtäglich eine Begründung meiner Existenz liefern zu müssen. Dieses Gefühl nehme ich als Grundlage eines Plädoyers für eine Poetik der Bastarde der Globalisierung.
Zweiter Aufzug
Bastarde der Globalisierung
„Bastarde der Globalisierung“ ist der Titel des zweiten Bandes von Yellow Press, der Anthologie von korientation, die aus einer „Auswahl von Artikeln von zumeist KoreanerInnen der zweiten Generation“ besteht (S. 6). Der Titel selbst wurde aus dem Artikel „Punk Rock In Gelb-Weiß“ von Ilhan Özgen genommen, „in dem er betont, weder Halbkoreaner noch Halbtürke zu sein. „Ich sehe mich eher als einer der zahllosen Bastarde der Globalisierung, die nicht wissen, was sie sind.“ (S. 7). Ich würde gerne versuchen, an dieses Weder-noch-sein im Rahmen der hinterfragten Legitimität heranzugehen. Bastarde der Globalisierung sind Menschen, deren Existenz und Dasein in der Regel immer wieder über relational bestimmte Legitimationsprozessen hinterfragt und geprüft aber nie eigenständig anerkannt werden. Denken wir zurück an den Fall von John the Bastard. Hier scheinen mir Fragen wie „Wo kommst du wirklich her?“ eine Art Hinterfragen der Legitimität zu sein oder auch eine normalisierende Strategie, die dazu dient, die Illegitimität der Person, des Weder-dies-noch-jenes-seins, vom Bastard selbst bestätigt zu bekommen, damit die Ordnung der Welt wiederhergestellt werden kann. Identität ist eine Bedrohung, wie Kim sagt, für die Bastarde, weil unsere Existenz die hegemonische, m.E. imperialistische Weltordnung bedroht. Dieser Weltordnung nach gebe es keine „HalbkoreanerInnen“, keine „HalbtürkInnen“ und auch keine ChilenInnen, die wie ich aussehen, weil sie nicht zu der anerkannten Rassen der jeweiligen Weltregion gehören. Globalisierung in der Form von Warenhandel, Tourismus und Ausbeutung ohne Grenzen schon.
Da unterscheiden wir uns von unseren Eltern, denn selbst wenn die dominante Gesellschaft ihre Identität hinterfragt, haben unsere Eltern vor der Auswanderung kein Hinterfragen der Zugehörigkeit und Identität auf dieser Ebene erlebt. Dahingegen müssen sich die Bastarde der Globalisierung von Geburt an auf deren Verhältnis zu einem legitimen Prince of Arragon stützen, zu unseren Eltern, um die einzige Art von gesellschaftlicher Akzeptanz zu erringen, die sie zu erreichen erhoffen dürfen: Die Anerkennung ohne Anspruch auf Selbstbestimmung. Wenn ich gefragt werde, woher ich wirklich herkomme, wird die gesellschaftliche Akzeptanz meiner Existenz verweigert, bis ich mein Verhältnis zu meinen legitimen, sprich der rassistischen Weltordnung konformen Vorfahren wie ein Ausweis vorgezeigt habe. Erst dann ist es sittlich, mich zu empfangen.
Ich denke aber, dass selbst wenn der Bastard die legitimierende Antwort gibt, bleibt eine Unzufriedenheit in uns zurück, oder vielleicht hoffen wir in solchen Momenten, eines Tages keinen Beißkorb mehr zu brauchen. Die Hoffnung, dass es einen Weg für die Bastarde der Globalisierung gibt, sich von der unerreichbaren aber notwendigen Legitimität befreien zu können, unterscheidet uns auch von unseren Eltern.
Literatur als ein möglicher Weg zur Befreiung ist das Hauptthema von diesem Beitrag. Wie bereits erwähnt, geht es hier nicht um einen Bericht über die Literaturen Lateinamerikas, sondern um ein Plädoyer für die Selbstbestimmung der Bastarde der Globalisierung, für die Etablierung einer literarischen Gattung, die uns von der externen Akzeptanz befreien kann. Hier meine ich weder Exil- noch Migrantenliteratur, zwei Literaturgattungen, wo wir häufig verwandte Themen finden. Nehmen wir den deutschen Autor Martin Hyun als Beispiel, beziehe ich mich auf Narrativen wie „Lautlos – ja, sprachlos – nein. Grenzgänger zwischen Deutschland und Korea“ (2008). Im Gegensatz zu „Gebrauchsanweisung für Südkorea“ (2018), wo Hyun sich hauptsächlich deskriptiv mit dem Herkunftsland seiner Eltern befasst und die Rolle einer Art Brücke für deutsche LeserInnen spielt, beschreibt er einen der Gründe für seine erste Veröffentlichung wie folgt:
Wenn die Sprache und höhere Bildung neben der Einbürgerung alleine Zugang und Gleichstellung in die deutsche Gesellschaft gewähren, haben wir [Deutsche-KoreanerInnen] alle Kriterien erfüllt. Dann würde dieses Buch ohne Bedeutung sein, ein Buch,
das niemand braucht.
(Hyun 2008, S. 21)
Die Notwendigkeit und Bedeutung von Veröffentlichungen wie „Lautlos – ja, sprachlos – nein“ ist erst eindeutig, wenn man sie im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Realität aus der postmigrantischen Perspektive betrachtet, die sich eher mit dem Zugang und der Gleichstellung als mit dem Kulturaustausch auseinandersetzt. Darüber hinaus ist eine entsprechende Rezeptionsästhetik unentbehrlich, also dass eine Poetik der Bastarde der Globalisierung gleichzeitig global lesbar gemacht wird, sodass Chile auch Österreich und Deutschland lesen kann. Dies beginnt mit einem Umdenken der Übersetzung.
Dritter Aufzug
Übersetzung, die Sprache der Kinder
Die Wörter „Tusán“, „Nikkei“ und „Ise“ sind Übersetzungen aus verschiedenen ostasiatischen Sprachen, nämlich Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Statt über das Verhältnis zwischen Sprache, Bedeutung und Übertragung zu sprechen, scheint mir eine Unterscheidung zwischen der Sprache der Eltern und der Sprache der Kinder besser geeignet zu sein. In den Sprachen der Eltern, bedeuten diese Wörter etwa „hier geboren“, „genealogisch japanisch“ und „zweite Generation“. Wir sehen also, dass in der Sprache der Eltern der Geburtsort, die Nationalität sowie die Nummerierung drei verschiedene Möglichkeiten darstellen, das Kind sprachlich im Verhältnis zu dem migrantischen Elternteil einzuordnen.
Dennoch werden diese drei Wörter ganz anders in der Sprache der Kinder verwendet, oder zumindest besteht die Möglichkeit, sie ganz anders zu lesen. Zwar sind sie Übersetzungen, die zweifelsohne mit deren Ursprung verbunden bleiben, wie der Nachwuchs mit seinem Vorfahren, die aber gleichzeitig eigene Ausprägungen besitzen und andere Bedeutungen gewinnen. Wir sind letztendlich auch nicht ganz unsere Eltern.
土生 日系 이세
tusán nikkei ise
In der Sprache der Eltern bezieht sich die japanische Bezeichnung „日系“ auf die erste sowie auf alle weiteren Generationen, die außerhalb Japan wohnhaft sind. „Nikkei“ in der Sprache der Kinder bezieht sich häufig ausschließlich auf den Nachwuchs von japanischen MigrantInnen. Der nikkei und peruanische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Carlos Yushimito del Valle schreibt:
El término nikkei se emplea, en general, para designar a los sujetos de la herencia japonesa (incluyendo a los de
ascendencia mixta, bien por vía materna o bien por vía paterna) nacidos fuera de Japón.
(Yushimito 2017, S. 292, 4. Fußnote)
[Die Bezeichnung nikkei bezieht sich generell auf Personen japanischer Abstammung (einschließlich mütterlich- oder väterlicherseits), die außerhalb Japans geboren sind.]
Die charakteristische Besonderheit dieser Wörter ist, dass ihnen neue Bedeutungen sowie Verwendungsformen zugeschrieben werden (können). Wir haben die Möglichkeit, ihre semantische Eigenständigkeit zu legitimieren, statt sie als Ableitungen von einem ursprünglichen Original, die einfach in eine andere Sprache übertragen werden, zu betrachten. Indem wir „Tusán“, „Nikkei“ und „Ise“ bewusst als eigenständige Wörter gelten lassen, die ohne einer ursprünglichen Sprache anzugehören legitim sein können, bewirken wir eine kreative Transformation. Aus der Bewegung zwischen zwei Sprachsystemen entsteht (kreativ) etwas Neues (transformativ), das zwar einer oder mehreren Quellen hervorgeht aber in einem völlig anderen System eine völlig andere Rolle zu spielen hat. „Ise“ stammt aus dem Koreanischen „이세“, aber sie sind keineswegs identisch. Während „이세“ sich auf das koreanische Sprachsystem beschränkt, ist das Wort „Ise“ in anderen Sprachen lesbar. Das heißt, dass es neue und konkrete Verwendungsformen innerhalb des neuen Systems benötigt, zum Beispiel Rechtschreibung („Ißä“ oder „Isse“?) und Grammatik (Klein- und Großschreibung, Kasus und Beugung?). Die schriftliche Romanisierung als ein transformativer und kreativer Prozess ist eine der Spuren, an dem man die Sprache der Bastarde der Globalisierung erkennen kann.
Dabei ist mein Ziel keineswegs die regionalen und historischen Unterschiede außer Acht zu lassen. Diese drei Wörter können in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen sein. Während „土生“ zum Beispiel auch in Südostasien bekannt ist, findet man das Wort „Tusán“ überwiegend wenn nicht ausschließlich in Peru. Und zwar scheint das Wort keine phonetische Ableitung vom Hochchinesisch zu sein, oder zumindest entspricht es keinen der staatlich anerkannten Romanisierungsformen des Hochchinesischen (zum Beispiel „T’u Sheng“). Vermutlich handelt es sich also um eine Romanisierung von einer der Sprachen im Südosten Chinas, denn aus dieser Region stammte die Mehrheit der ersten MigrantInnen, die im 19. Jahrhundert nach Peru eingewandert sind. Staatlich anerkannte Sprachen und Romanisierungssystemen sind nicht in der Lage, die Geschichte aus diesem Blickwinkel zu erzählen, eben weil sie eine universale Geltung bzw. keine konkrete Zielsprache haben sollen. Die Romanisierung „T’u Sheng“ ist weder Hochchinesisch noch Spanisch, während „Tusán“ die Geschichte Perus in mehreren Sprachen, in der Sprache der Kinder erzählt.
Die Sprache der Kinder erzählt uns also eine meistens inoffizielle Geschichte der Globalisierung, die darüber hinaus stark von Emotionen geprägt ist. Genau dies ist der Fall mit dem Wort „Gaijin“. Ins Deutsche übertragen heißt das japanische Wort etwa „AusländerIn“, aber in dieser Zeichenform und in diesem Zusammenhang hat das Wort „Gaijin“ eher mit der Problematisierung der eigenen Zugehörigkeit zu tun. Nicht ohne Grund tragen die Romane von zwei verschiedenen nikkei Autoren aus verschiedenen Ländern und Generationen den gleichen Titel: „Gaijin“ von Augusto Higa aus Peru (geb. 1946) und „Gaijin“ von Maximiliano Matayoshi aus Argentinien (geb. 1979).
Alle vier Wörter, „Tusán“, „Nikkei“, „Ise“ und „Gaijin“, gelten als Fremdwörter in dem deutschen sowie in dem spanischen Sprachsystem, weshalb sie häufig in Anführungszeichen gesetzt oder kursiv geschrieben werden. Auf Spanisch schreibe ich sie bewusst ohne solche schriftliche Differenzmarkierungen, die auf die Fremdheit des Begriffes hinweisen. Für mich ist das eine kleine politische Aktion, die darauf zielt, diese Wörter in ihrer schriftlichen Form zu normalisieren, denn die spanische Sprache gehört mir auch. Die Stadt Santiago und das Land Chile sind auch meine Stadt und mein Land. Dementsprechend muss meine Sprache meine Lebensrealität, an der meine tusán, nikkei und ise chilenischen Mitmenschen teilhaben, widerspiegeln können. Ein ähnliches Prinzip hat die Aktivistin und Schriftstellerin Cherríe Moraga, eine der bedeutendsten Figuren der feministischen Bürgerrechtsbewegung der mexikanischen Diaspora in den U.S.A., in dem Vorwort ihres Buches „A Xicana Codex of Changing Consciousness“ wie folgt beschrieben:
Spanish words are neither translated nor italicized (unless for emphasis) in order to reflect a bilingual Xicana sensibility. No glossary is provided, since most readers, if they do not have some basic knowledge of Spanish, will easily be
able to find a Spanish dictionary.
(Moraga 2011, S. xxii)
[Spanische Wörter werden weder übersetzt noch kursiv geschrieben, außer wenn sie betont werden, um ein zweisprachiges xicana Bewusstsein widerzuspiegeln. Kein Glossar ist vorhanden, da die Mehrheit der LeserInnen ein spanisches Wörterbuch problemlos finden können, wenn sie über keine grundlegenden Spanischkenntnisse verfügen.]
In diesem deutschsprachigen Beitrag werde ich auf die Differenzmarkierung von den Adjektiven „tusán“, „nikkei“ und „ise“ verzichten, um alle LeserInnen, denen die deutsche Sprache auch gehört, einzuladen, sich eine vergleichbare Aktion im deutschsprachigen Raum vorzustellen. Letztendlich dürfen viele Fremdwörter wie „supporten“, „abchecken“ und „interviewen“ diesen figurativen Raum betreten. Warum auch nicht „gaijin“? Oder gilt das nur für Anglizismen? Was für eine Türpolitik führt die deutsche Sprache?
Lass uns zurück zu unseren Gefühlen und unseren Eltern. In einem Interview aus dem Jahre 2014 spricht Anna Kim über eine „emotionale Bindung“ zu ihrer Muttersprache, die nicht ihre erste Sprache sei:
Der Wechsel der Muttersprache muss meiner Meinung nach kurz davor oder in den ersten Volksschuljahren passiert sein, zeitgleich mit einer Verschiebung der Identität. […] Ab dann wurde das Deutsche immer dominanter und seit damals ist es die dominante Sprache, meine erste Sprache. Muttersprache nenne ich das Deutsche nach wie vor nicht, da ich eine emotionale Bindung zum Koreanischen habe. Es ist ganz eigenartig: Wenn immer meine Mutter bestimmte koreanische Wörter sagt, die ich als Kind immer wieder gesagt bekommen habe, spüre ich eine Verbundenheit, die ich sogar Heimatgefühl nennen würde, allerdings nur
mit einzelnen Wörtern, nicht mit der ganzen Sprache.
(Kim 2014, S. 136)
Eine ähnliche emotionale Bindung zur Sprache finden wir in dem Roman „Mongolia“ von der tusán peruanischen Autorin Julia Wong Kcomt. In ihrem Roman geht es um eine Protagonistin namens Belinda, die nach dem Tod ihres Vaters von Peru nach Macau zieht, wo sie eine Wohnung geerbt hat. Für Belinda hat die Sprache ihres Vaters vor allem mit ihren Emotionen zu tun.
Tampoco tenía intenciones de aprender correctamente ni chino ni portugués. […] Mi vocabulario escueto solía convertirse en oraciones acertadas para no pasar hambre. Pero ¿a quién le podía importar?, al único ser humano que le pudo importar ya no
estaba, ¿para qué hablar otro idioma, para qué hablar chino? ¿para quién?
(Wong 2015, S. 26)
[Ich hatte es auch nicht vor, weder Chinesisch noch Portugiesisch ordentlich zu lernen. […] Mein spärliches Vokabular hat sich meistens in Sätze gewandelt, die lediglich dazu dienten, nicht zu verhungern. Aber für wen wäre es wichtig? Der einzige Mensch, dem es wichtig sein könnte, war nicht mehr da. Wozu eine andere Sprache sprechen, wozu Chinesisch sprechen? Für wen?]
Selbst wenn wir sie nicht sprechen können, spüren wir die Sprache. Sie ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, viel mehr spielt die Sprache der Kinder eine affektive Rolle in unserem Leben. Für uns hat der Begriff „Muttersprache“ vielmehr mit emotionalen Bindungen als mit Sprachkenntnissen zu tun.
Ein weiteres Beispiel finden wir in der Veröffentlichung „Mudas las garzas“ der mexikanischen Schriftstellerin Selfa Chew. In einigen von ihren Vorträgen und Interviews erzählt sie, dass ihr Vater aus der kantonesischen Region Chinas nach Mexiko eingewandert war bzw. dass sie mütterlicherseits aus einer „Mixteca“-Familie, einer der indigenischen Bevölkerungen in Mexiko, stammt. Als Kind sei sie zusammen mit einer japanischen Familie im Norden Mexikos aufgewachsen. „Mudas las garzas“ ist eine Mischung aus Prosa, Dichtung, Fotografien und Interviews sowie wahren und fiktionalisierten Erzählungen, die den vernachlässigten Geschichten der zahlreichen JapanerInnen und nikkei MexikanerInnen, die während des zweiten Weltkriegs verfolgt, festgenommen und abgeschoben wurden, kollektiv eine narrative Stimme gibt. Besonders interessant für uns ist ein kurzer Satz auf Seite 24, wo ein Kind mit seiner Mutter spricht.
Okasan, no me importará si los otros se burlan de mí, comeré sus triangulitos de onigiri en el recreo y le llamaré siempre „okasan“, aunque sepa decir también „madre“, „mamá“ y „ternura“.
(Chew 2007, S. 24)
[Okasan, egal wenn sich die Anderen über mich lustig machen, ich werde Ihre Onigiri-Dreieckchen in der Pause essen und Sie immer „Okasan“ nennen, selbst wenn ich auch „Mutter“, „Mama“ und „Zärtlichkeit“ sagen kann.]
Hier finden wir wieder die emotionale Bindung zur Sprache. Wir sehen die Übersetzung als Sprache der Kinder; wir sehen einen Versuch, über der Sprache mit dem Anderssein umzugehen. Dieses emotionale Verhältnis zur Sprache ist das Hauptmerkmal der Poetik der Bastarde der Globalisierung.
Vierter Aufzug
Verbundenheit
Diese Herangehensweise zur Sprache ermöglicht uns aus emotionalen Bindungen translinguale Brücken zu bauen, die unter anderen Umständen nicht hätten entstehen können. Insbesondere denke ich an eine Kurzerzählung von Anna Kazumi Stahl. Kazumi ist in den USA geboren und lebt seit mehreren Jahren in Argentinien, wo sie derzeit als Schriftstellerin, Übersetzerin und Dozentin tätig ist. In „El testigo chino“ inszeniert sie eine Situation in New Orleans, wo es einer japanischsprachigen Dolmetscherin gelingt, im Auftrag der Polizei einen schwerverletzten chinesischsprachigen Zeugen über einen Überfall zu befragen — und zwar schriftlich statt mündlich. Natürlich ist Kazumi nicht der allererste Mensch, der es bemerkt hat, dass zwischen Japanisch und Mandarin ausreichende Gemeinsamkeiten im Schriftlichen bestehen, um sich einigermaßen gegenseitig verstehen zu können. Aber ich wage es zu behaupten, dass sie die Erste ist, dies auf Spanisch in literarischer Form darzustellen.
Das erfüllt einen bestimmten Zweck. Da wo stereotypische Gleichsetzungen üblich sind, gelingt es Kazumi, ein Gegennarrativ zu schaffen, das in der Lage ist, eine inter-linguistische Verbindung ohne rassistische Stereotypen darzustellen. Nachdem die Dolmetscherin ihm gesagt hat, dass sie nicht mit dem Mann sprechen kann, weil er Chinese ist, antwortet der blonde Polizist:
‚Bueno, entonces, háblele despacio, señora. Chino, japonés, da lo mismo. Si no, no la hubiéramos traído, ¿no le
parece?’
(Kazumi 1997, S. 158)
[„Gut, dann sprechen Sie langsam mit ihm. Chinesisch, Japanisch, egal. Sonst hätten wir Sie ja nicht hierherkommen lassen, finden Sie nicht?“]
Hier möchte ich ganz kurz auf eine andere Kurzerzählung hinweisen. In „Partir“ („Abreisen“ oder auch „Aufbrechen“) von der nikkei Argentinierin Alejandra Kamiya wird die folgende Szene von der Erzählerin beschrieben:
Los otros chicos se estiraban los ojos con los índices y me decían „china“. Yo les decía que era japonesa y ellos decían
que era lo mismo.
(Kamiya 2008, S. 20)
[Die anderen Kinder zogen sich die Augen mit den Zeigefingern und nannten mich „Chinesin“. Dann sagte ich ihnen, dass ich Japanerin war, und sie sagten, das sei das Gleiche.]
Solche Darstellungen von Rassismuserfahrungen tauchen in weiteren Texten von tusán, nikkei und ise SchrifttellerInnen auf, wo die Augen als Hauptmerkmal des Andersseins fungieren und tusán, nikkei und ise Figuren trotz allen Erklärungen und Argumenten für „Chinesen“ gehalten werden. Ich vermute nämlich, dass diese Fixierung mit China wahrscheinlich mit der Migrationsgeschichte des Kontinentes zu tun hat. Nachdem die Sklaverei nach und nach in Amerika abgeschafft wurde, haben die europäischen Kolonialmächte im 19. Jahrhundert hunderttausende Menschen hauptsächlich aus Kanton, aber auch aus den damals spanischen Philippinen und aus Indien, unter unmenschlichen Bedingungen über den pazifischen Ozean in die Häfen in Mexiko, Panama und Peru geschleppt. Die sogenannten „culíes“ waren die ersten MigrantInnen aus Asien, die in großen Zahlen die Reise überlebt hatten. Sie haben auf den Plantagen in Kuba gearbeitet, sowie die Eisenbahn in Kalifornien und den Panama-Kanal gebaut. Ich bin keine Historikerin und keine Soziologin, aber ich vermute, dass diese rassistische Stereotypisierung aus diesem vernachlässigten Ereignis der Geschichte des Kolonialismus zurückzuführen wäre. Ein anderes Beispiel. Eine chilenische Kollegin hat mir vor ein paar Monaten erzählt, dass in den letzten Jahren koreanische Pop-Musik in unserer Heimat sehr beliebt ist. Sie berichtete, dass K‑Pop Gruppen üblicherweise auch als „cantantes chinitos“ (etwa „chinesische Sänger“, wobei „chinesisch“ in der männlichen Verkleinerungsform verwendet wird) bezeichnet werden.
Aber lass uns zurück zu der Dolmetscherin und dem Zeugen springen. Die Tatsache, dass Kazumi auf Spanisch schreibt, scheint mir nicht unwichtig zu sein. Natürlich kann man das Argument hervorbringen, dass sie diese Situation für spanischsprachige LeserInnen zugänglich macht. Aber ich würde einen Schritt weiter wagen und behaupten, dass sie dadurch Spuren der Sprache der Kinder hinterlässt, die wir aus den Feinheiten ablesen können.
Abrió su cartera y sacó un lápiz y un pedazo de papel. Escribió en ideogramas que la lengua japonesa comparte con la china, a pesar de que habladas no tienen nada que ver, lo siguiente: ‚Perdóneme por incomodarlo. ¿Cuándo y dónde recibió las
heridas?’ Con el papel en la mano, se acercó aún más al chico herido y se lo mostró.
Estaba asustado, aterrorizado, y con razón. En ese instante silencioso, ella, la japonesa, ganó su confianza, y él escribió, con gran esfuerzo y dolor: ‚Nueve y media de la noche, a dos cuadras del muelle B’.
La interprete tomó el papel e inclinándose hacia la luz de la lámpara, lo descifró. Después, enfrentando a los policías reportó en voz alta: ‚Las heridas que lo están haciendo sufrir tanto ahora, fueron recibidas a las veintiuna treinta a dos
cuadras del muelle B’.
(Kazumi 1997, S. 158–159)
[Sie öffnete ihre Tasche und nahm einen Stift und ein Stück Papier heraus. In Piktogrammen, die die japanische Sprache mit der Chinesischen gemeinsam hat, die aber ausgesprochen nichts mit einander zu tun haben, schrieb sie das Folgende: ‚Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie stören muss. Wann und wo sind Ihre Verletzungen zustande gekommen?’ Mit dem Zettel in der Hand rückte sie dem verletzten jungen Mann noch näher und zeigte ihn ihm.
Er war erschrocken, entsetzt, und zu gutem Recht. In diesem lautlosen Moment gewann sie, die Japanerin, sein Vertrauen, und er schrieb mit großer Anstrengung und Schmerzen: ‚Halb neun abends, zwei Straßen vom Hafen B entfernt‘.
Die Dolmetscherin nahm den Zettel, beugte sich und entzifferte ihn unter dem Licht der Lampe. Dann wandte sie sich zu den Polizisten und berichtete: ‚Die Verletzungen, die ihm jetzt großes Leiden bereiten, sind um einundzwanzig Uhr dreißig zwei Straßen vom Hafen B entfernt zustande gekommen‘.]
In diesem Moment des Schweigens entscheidet sich der Zeuge, der japanischen Dolmetscherin zu vertrauen, lediglich weil er ihre Sprache erkennt, eine Sprache, die er selbst aber nicht spricht. Aus dieser emotionalen Reaktion entsteht eine Art Halbsprache. Diese emotionale Bindung, dieses plötzliche Vertrauen wäre vielleicht anders oder gar nicht möglich gewesen, wenn die Erzählung nicht an einem Ort stattgefunden hätte, wo beide Figuren eine Fremdsprache als Muttersprache sprechen würden. Die emotionale Verbundenheit, die die Sprache evozieren kann, selbst wenn sie keine legitime Sprache ist und lediglich als Halbsprache oder Übersetzung existiert, ist die Pointe, die ich betonen möchte.
Was uns vertraut ist, was wir erkennen, ist immer relativ zu dem, was uns entfremdet. Und gleichzeitig ist es eine bewusste Entscheidung, unserem Gegenüber zu vertrauen und uns selber in anderen Menschen zu sehen. Zusammen betrachtet zeigen uns Kazumi und Kamiya, dass Rassifizierung und Solidarität zwei Handlungsmöglichkeiten unter ähnlichen Bedingungen sind, sowie die dringende Notwendigkeit von Gegennarrativen, die uns durch die Sprache emotional verbinden können.
Fünfter Aufzug
Welt, Globus, Universum
Am Ende der Erzählung ruft Kazumis Dolmetscherin, Michiko Yamashita, bei der Zeitung an, um ihre Anzeige zurückzuziehen, worauf ihr Gesprächspartner, so der Erzähler oder die Erzählerin, am Rande eines Zettels den Namen „Michaki Yamata“ aufschreibt. Ich muss gestehen, dass ich ganz laut gelacht habe, als ich den Schluss der Erzählung zum ersten Mal gelesen habe. Ich dachte an meine zwei Namen und an alle Menschen, die sich allzu offensichtlich über die Tatsache gefreut haben, dass ich auch einen spanischen Namen hatte. Warum gibt man sich so wenig Mühe? Wenn ich mir die Namen von allen meinen Verwandten in Taiwan merken kann, sind die zwei Silben „Puo“ und „An“ sicherlich keine Herkulesaufgabe. Michiko hätte den Auftrag sofort absagen können. Nein, Japanisch und Chinesisch sind nicht das Gleiche. Warum hat sie sich also die Mühe gegeben? Unter welchen Bedingungen lohnt sich der Aufwand?
Wir werden immer enger miteinander vernetzt, aber die Globalisierung heißt bei Weitem nicht, dass alle Menschen die Welt gleich erleben, dass es universal geltende Werte gibt, die in den literarischen Werken von Shakespeare oder von Neruda in allen übersetzten Ausführungen zu finden sind. Vielmehr finde ich, dass wir als LeserInnen aus ihren Werken bestimmte Narrativen ablesen, die einen Rahmen für die Lesbarkeit unserer eigenen Welt bieten. Wir können uns alle in John the Bastard wiederfinden, wenn wir uns die Mühe geben.
Und wenn es einem Engländer im 16. Jahrhundert gelingt, alle Träume und Weisheiten der Welt in seinen englischsprachigen Werken darzustellen, sodass ein Chilene ihn vier hundert Jahre später auf Spanisch als den wichtigsten Dichter seiner Zeit feiert, könnten sich die Tusanes, Nikkeis, Ises und alle migrantisierten Menschen der Welt nicht über eine Poetik der Bastarde der Globalisierung solidarisieren, um uns selber zu legitimieren? Wenn die geltende Weltordnung uns nicht anerkennen kann oder will, ist es nicht notwendig, uns ein Universum vorzustellen, wo wir selbst über unseren Namen entscheiden dürfen?
Exeunt
Literaturverzeichnis
Chew, Selfa, Mudas las garzas, Ediciones Eón 2007.
Hyun, Martin, Lautlos – ja, sprachlos – nein. Grenzgänger zwischen Korea und Deutschland, EB-Verlag 2008.
Kamiya, Alejandra, „Partir“, in: Los que vienen y los que se van. Historias de inmigrantes y emigrantes en la Argentina, Fundación Banco Ciudad 2008.
Kazumi Stahl, Anna, Catástrofes naturales, Editorial Sudamericana Buenos Aires 1997.
Kim, Anna, „Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man eine Heimat hat“, in: Schwens-Harrant, Brigitte (Hg.), Ankommen, Styria Premium 2014, S. 127–168.
Kim, Anna, Invasionen des Privaten, Literaturverlag Droschl 2011.
korientation e.V. (Hg.), Bastarde der Globalisierung, Yellow Press – Band 2, korientation Berlin 2012.
Neruda, Pablo, „Inaugurando el año del Shakespeare“, in: Zeran Chelech, Faride (Hg.), Anales de la Universidad de Chile, Band 129 Januar – März, Universidad de Chile 1964, S. 5–18.
Moraga, Cherríe, A Xicana Codex of Changing Consciousness, Duke University Press 2011, S. xxi-xxii.
Shakespeare, William, Much Ado About Nothing, Signet Classic 1998.
Wong, Julia, Mongolia, Animal de Invierno 2015.
Yushimito del Valle, Carlos, „Archivos marginales de la pertenencia: representaciones del sujeto nikkei en La casa verde y la iluminación de Katzuo Nakamatsu“, in: García Liendo, Javier (Hg.), Migración y frontera: experiencias culturales en la literatura peruana del siglo XX, Vervuer